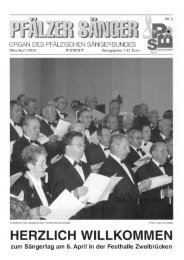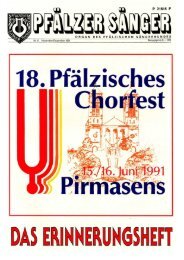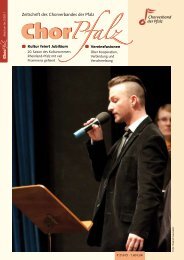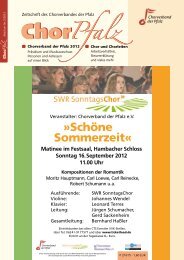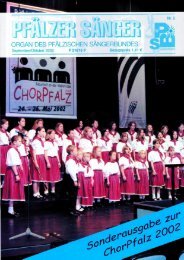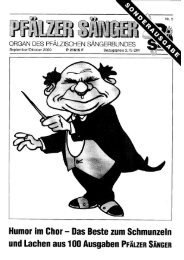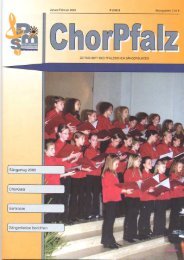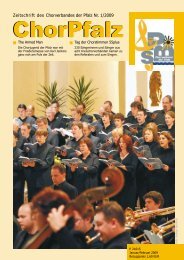Zeitlos – unvergänglich – unübertroffen - ChorPfalz online
Zeitlos – unvergänglich – unübertroffen - ChorPfalz online
Zeitlos – unvergänglich – unübertroffen - ChorPfalz online
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Seite 100 <strong>ChorPfalz</strong> September/Oktober 2008<br />
Volkslieder bilden keinen ehernen<br />
Kanon. Manche verschwinden für<br />
Jahrzehnte und tauchen taufrisch<br />
wieder auf. Andere bleiben über<br />
Generationen im allgemeinen<br />
Gedächtnis und überstrahlen die<br />
Namen ihrer Schöpfer. Unter den<br />
Komponisten und Dichtern der<br />
großen Evergreens finden sich<br />
fast alle großen Namen: Goethe,<br />
Eichendorff, Mozart, Schubert<br />
oder Brahms. Stil und Takt spielen<br />
Nebenrollen. Volkstümlich wird,<br />
worin sich Menschen wiederfinden<br />
können. Die beliebtesten<br />
Lieder gehen allen ins Herz,<br />
unabhängig von Status, Bildung<br />
und Herkunft. Sie handeln von<br />
Liebe und Trauer, Sehnsucht und<br />
Hoffnung, Freude und Leid, Sonne,<br />
Mond und Sternen.<br />
Wir können ja jetzt nicht miteinander<br />
singen, Sie und ich. Ich<br />
weiß nicht, wo Sie sich gerade<br />
aufhalten, wenn Sie diesen Text<br />
lesen. Sind Sie allein? Sitzen Sie<br />
in der Bahn oder liegen Sie im<br />
Freibad? Wenn Sie jetzt beginnen<br />
würden, leise vor sich hin<br />
zu summen, würde sich jemand<br />
umdrehen und Sie erstaunt anblicken?<br />
Oder wenn Sie gar lauthals<br />
sängen - zum Beispiel: „Die<br />
Gedanken sind frei, wer kann sie<br />
erraten“ -, was würde geschehen?<br />
Würde jemand einfallen in Ihren<br />
Gesang? Peinlich, schon alleine<br />
die Vorstellung? Dann doch lieber<br />
den MP3-Player anwerfen, die<br />
Earphones einstöpseln, sich Verdi<br />
reinziehen oder Mozart, Sido und<br />
Bushido, Hip-Hop, Heavy Metal.<br />
Oder vielleicht ein Volkslied?<br />
Es gibt kulturelle Phänomene, die<br />
mehr als andere verraten, dass<br />
sich die Zeiten geändert haben.<br />
Relikte, Überbleibsel aus Epochen,<br />
in denen man selbst aktiv werden<br />
musste, wenn man sich die Zeit<br />
vertreiben wollte. Die historischen<br />
Volkslieder zählen dazu.<br />
Da saßen sie abends unter den<br />
Linden, die Leute aus dem Dorf.<br />
Es dämmerte, das Tagwerk war<br />
vollbracht. Der Tischler wollte<br />
nicht über Hobelspäne reden und<br />
die Bäuerin nicht über die geronnene<br />
Milch. Und zum zwanzigsten<br />
Mal die Geschichten des<br />
Arnd Brummer<br />
Freie Gedanken und<br />
ein Lied vom Mond<br />
Onkels hören, wie er selbigesmal<br />
beim Holzmachen von den Wildschweinen<br />
gejagt wurde, wollte<br />
auch keiner. Nur gut, dass Hedwig<br />
in diesem Augenblick glockenhell<br />
zu singen begann: „Kein schöner<br />
Land in dieser Zeit als hier das<br />
unsre weit und breit, wo wir uns<br />
finden wohl unter Linden zur<br />
Abendzeit.“ Den Text kannten<br />
alle. Der Tischler brummte mit,<br />
die Bäuerin stimmte in warmem<br />
Alt ein. „Jetzt, Brüder, eine gute<br />
Nacht…“<br />
Es stimmt, dass die Menschen<br />
früher zusammen mehr sangen<br />
und viele Lieder auswendig<br />
wussten. Dass sie dies als etwas<br />
Besonderes betrachtet hätten,<br />
gehört ins Reich sozialromantischer<br />
Legenden. Das Auswendigkönnen<br />
und Selbersingen<br />
war schlicht und einfach eine<br />
der besten Möglichkeiten, Langeweile<br />
zu vertreiben. Und dass<br />
dies in dörflicher und häuslicher<br />
Gemeinschaft geschah, war der<br />
mangelnden Mobilität geschuldet.<br />
Manche begabte Sängerin<br />
wird es als wenig idyllisch erlebt<br />
haben, wenn sie mit denen<br />
abends singen musste, mit denen<br />
sie tagsüber Kartoffeln geerntet<br />
oder Wäsche gewaschen hatte.<br />
Es war halt so.<br />
Wenn einmal in vielen Wochen<br />
der Leierkastenmann oder ein<br />
anderer fahrender Gesell ins<br />
Dorf kam und ein neues Lied<br />
mitbrachte, war das die lang<br />
ersehnte Abwechslung im alltäglichen<br />
Einerlei. Wer den Hit<br />
komponiert oder getextet hatte,<br />
wusste der fahrende Sänger<br />
meist nicht. Er hatte ihn selbst<br />
irgendwo aufgeschnappt, seinen<br />
musikalischen Möglichkeiten<br />
angepasst, also umgetextet oder<br />
melodiös vereinfacht.<br />
Als im ersten Drittel des 20.<br />
Jahrhunderts Radio und Schallplatte<br />
aufkamen, im zweiten<br />
schließlich das Fernsehen, versammelten<br />
sich die Familien<br />
mit dem Gefühl der Befreiung<br />
um die Geräte. An die Stelle<br />
regionaler Sangesbräuche trat<br />
die universale Hitmaschine. Wer<br />
recht in Freude wandern wollte<br />
oder die Mühle am rauschenden<br />
Bach klappern hörte, galt bald<br />
als liebenswürdig überständig.<br />
Und dass die deutschtümelnden<br />
NS-Propagandisten im deutschen<br />
Lied ein völkisches Erbe<br />
erblickten, trug zum Niedergang<br />
desselben das Seine bei. Wer mit<br />
der Zeit gehen wollte, sang „Let<br />
it be“ oder grüßte „See you later,<br />
Alligator“, anstatt die Vogelhochzeit<br />
zu besingen.<br />
Dieser zugegeben brachiale Ritt<br />
durch die jüngere Musikgeschichte<br />
beschreibt ein wenig<br />
verkürzt, wie wir dahin gekommen<br />
sind, wo wir sind. Er ist<br />
weder Demonstration eines wehleidigen<br />
Kulturpessimismus noch<br />
Ausdruck geschichtsvergessener<br />
Fortschrittseuphorie. Er illustriert,<br />
dass die Tradition (auf deutsch:<br />
Übermittlung) des Volksliedes zu<br />
einem schmalen Rinnsal geworden<br />
ist, alleine noch unterhalten<br />
von einer Handvoll Popsängern,<br />
die je nach Zielgruppe die eher<br />
demokratischen oder heimeligen<br />
Inhalte präsentierten, sowie von<br />
Pfadfinderliederbüchern wie<br />
„Mundorgel“ und „Kilometerstein“,<br />
in der die eiserne Ration<br />
des Liedgutes in immer kleinere<br />
Kreise weitergereicht wurde. Die<br />
historischen Volkslieder, hinter<br />
denen die Namen von großen<br />
Poeten wie Heinrich Heine oder<br />
Matthias Claudius stecken, verschwinden<br />
im lauten Stimmengewirr<br />
der allgegenwärtigen<br />
U-Musik.<br />
Und das genau ist die Chance,<br />
die Volkslieder in ihrem Wert und<br />
Gehalt neu zu entdecken. Indem<br />
„Der Mai ist gekommen“ oder das<br />
„Heideröslein“ aufgehört haben,<br />
populäre Gebrauchslieder zu sein,<br />
finden Texte und Melodien die<br />
Aufmerksamkeit einer Generation,<br />
die in ihnen die Kraft und Energie<br />
großer Kunst erleben kann,<br />
gerade weil sie nicht mehr alltäglich<br />
verfügbar sind. Friedrich<br />
Silchers „Ännchen von Tharau“<br />
oder „Guten Abend, gute Nacht“<br />
von Johannes Brahms entpuppen<br />
sich als große Kunst. Sie teilen<br />
das Schicksal von Möbeln, die<br />
deshalb zu teuer gehandelten<br />
und liebevoll restaurierten Raritäten<br />
und Antiquitäten werden<br />
konnten,weil sie der trivialen<br />
alltäglichen Benutzung entwachsen<br />
sind.<br />
Ihre Qualität steckt in der Erkenntnis,<br />
dass sie überstanden,<br />
weil sie auch modernen Ohren<br />
und Gehirnen noch etwas zu<br />
sagen haben. Sie haben sich von<br />
ihrem Zweck emanzipiert. Die<br />
Worte und Weisen bekommen<br />
einen neuen Sinn, weil sie für<br />
Menschen getextet und komponiert<br />
sind und nicht für Soundmaschinen.<br />
Jede und jeder kann