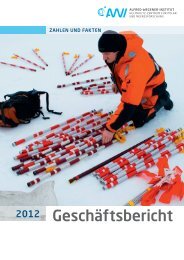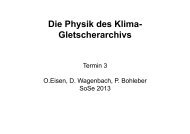Solare und terrestrische Strahlungswechselwirkung zwischen ... - AWI
Solare und terrestrische Strahlungswechselwirkung zwischen ... - AWI
Solare und terrestrische Strahlungswechselwirkung zwischen ... - AWI
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Eigenschaften von Rockel et al. [1991] verwendet.<br />
Für den solaren Spektralbereich erweist sich das modifizierte Modell als am besten geeignet.<br />
Die optischen Wolkeneigenschaften (optische Dicke, Einfachstreualbedo <strong>und</strong> Asymmetriefaktor)<br />
werden nach Slingo [1989] parametrisiert. Die Modifikation bezieht sich<br />
auf die -Eddington-Approximation. Dabei bleibt die Behandlung der diffusen Strahlung<br />
unverändert, nur die Berechnung der direkten Strahlung wird auf Basis der analytischen<br />
Henyey-Greenstein-Phasenfunktion realistischer formuliert. Die Berechnung der Strahlungsflußdichten<br />
erfolgt nur im Bereich der Wolken. Dazu wird für das <strong>terrestrische</strong> Modell<br />
die Gegenstrahlung am Oberrand <strong>und</strong> die Ausstrahlung am Unterrand des Modells<br />
aus den Flußdichtemessungen vorgegeben. Beim solaren Strahlungstransport-Modell wird<br />
die Globalstrahlung (obere Modellgrenze) <strong>und</strong> die Albedo (untere Modellgrenze) aus den<br />
Messungen vorgegeben. Für beide Modelle ergibt sich die Aufteilung der Flußdichten auf<br />
die spektralen Intervalle<br />
der Global- <strong>und</strong> Gegenstrahlung an der Wolkenobergrenze durch Rechnungen mit dem<br />
Modell MODTRAN 3.7. Diese Rechnungen erfolgen für sommerliche, arktische Profile<br />
der Temperatur, Feuchte, Spurengase <strong>und</strong> Sonnenzenitwinkel. In die spektrale Aufteilung<br />
der Intervalle geht der Zenitwinkel der Sonne mit ein.<br />
Die rechten Grafiken der Abbildungen 6.14 zeigen den Flüssigwassergehalt m (gestrichelte<br />
Linien) <strong>und</strong> den mittleren Teilchendurchmesser d (durchgezogene Linien). Diese Daten<br />
stammen aus Messungen von Teilchenspektren mit der FSSP-100 Sonde [Hartmann et al.,<br />
1997].<br />
Tabelle 6.8 zeigt einige strahlungsrelevanten Eigenschaften. Die unterste Zeile gibt die<br />
Mittelwerte <strong>und</strong> Standardabweichungen aller 31 Meßprofile während REFLEX III wider.<br />
Weitere Meßgrößen können den Tabellen 6.1 <strong>und</strong> 6.2 entnommen werden. Die optimierte<br />
ZSA wird anhand gemessener Flußdichteprofile mit maximaler <strong>und</strong> minimaler Flüssigwassersäule<br />
<strong>und</strong> Teilchendurchmesser überprüft. Die Variation der fünf ausgewählten Meßfälle<br />
beträgt für die Flüssigwassersäulen 4.1 bis 78.3 g m ,2 ,für den Teilchendurchmesser d 3.9<br />
bis 15.7 m aber der Zenitwinkel ist mit 60.1 bis 63 nahezu konstant. Die kurz- <strong>und</strong> langwellige<br />
optische Dicke beschreibt den Mittelwert über die optischen Dicken der jeweiligen<br />
solaren oder <strong>terrestrische</strong>n Spektralbereiche.<br />
Tabelle 6.8: Zusammenstellung der strahlungsrelevanten Wolkeneigenschaften<br />
Profil Nr. optische Dicke Flüssigwassersäule mittlerer Durchmesser Zenitwinkel<br />
langw. kurzw. g m ,2 m deg<br />
r22 6 1 11.2 15.2 78.25 10.4 60.1<br />
r12 7 2 8.4 10.6 50.80 15.7 61.8<br />
r20 7 2 2.4 3.5 13.99 12.2 61.6<br />
r23 7 2 0.8 1.2 4.12 3.9 62.1<br />
r24 7 8 0.9 1.6 5.37 13.8 63.0<br />
Mittelwerte der 31 Meßfälle: 27.7 18.5 11.9 3.5 63 2