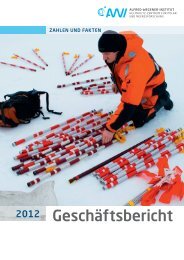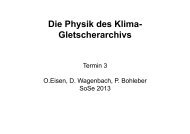Solare und terrestrische Strahlungswechselwirkung zwischen ... - AWI
Solare und terrestrische Strahlungswechselwirkung zwischen ... - AWI
Solare und terrestrische Strahlungswechselwirkung zwischen ... - AWI
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Abbildung 5.8 zeigt die Abkühlungsrate, die Größenverteilung der Wassertropfen, die<br />
Varianzen der potentiellen Temperatur sowie der Windkomponenten. In Abbildung 5.9<br />
wird die vertikale Temperaturverteilung in den drei Bereichen dargestellt. Diese Profile<br />
werden durch Mittelung von 6 bis 9 Meßprofilen gewonnen.<br />
In der Region (1) mit höherer Bewölkung ist die Nettoflußdichte <strong>zwischen</strong> den beiden<br />
Schichtwolken nahe Null. Die Absorption solarer Strahlung bewirkt eine leichte Wärmezufuhr<br />
in der unteren Wolke <strong>und</strong> stabilisiert damit die Luftsäule. Dieser Zustand ist in<br />
den oberen drei Grafiken der Abbildung 5.8 dargestellt. Die linke Grafik zeigt die totale<br />
Abkühlungsrate in Kelvin pro St<strong>und</strong>e. Ein negativer Wert bedeutet, daß der Wolke<br />
durch Strahlung Wärme zugeführt wird. Dieser stabilisierende Effekt zeigt sich auch in der<br />
geringen Varianz der potentiellen Temperatur <strong>und</strong> Windgeschwindigkeit.<br />
In der Region 3 (untere Grafiken der Abbildung 5.8) überwiegt der Wärmeverlust durch<br />
langwellige Ausstrahlung (linke Grafik). Der Wärmeverlust zeigt Wechselwirkungen mit<br />
den mikrophysikalischen <strong>und</strong> dynamischen Meßwerten. Die Varianz der potentiellen Temperatur<br />
ist im oberen Bereich der Wolke deutlich erhöht <strong>und</strong> die horizontale Windgeschwindigkeit<br />
fluktuiert in der gesamten Grenzschicht. Gegenüber der Region 1 hat sich in der<br />
Region 3 die Anzahldichte der Teilchen signifikant erhöht. Aus Satellitenaufnahmen <strong>und</strong><br />
den Meßdaten ist die Zeit seit Beginn der Strahlungsabkühlung mit 30 min bestimmen<br />
worden.<br />
Höhe Höhe<br />
Höhe<br />
350m<br />
300m<br />
250m<br />
200m<br />
-2 0 2 4<br />
350m<br />
300m<br />
250m<br />
200m<br />
-2 0 2 4<br />
350m<br />
300m<br />
250m<br />
1<br />
2<br />
3<br />
200m<br />
-2 0 2 4<br />
Kühlungsrate<br />
K/h<br />
Anzahldichte cm μm<br />
1000 1000<br />
1000<br />
u’²<br />
Θ’²<br />
10 20 300<br />
1 2<br />
40004000<br />
4000<br />
10 20 300<br />
1 2<br />
1000 1000<br />
2000<br />
6000<br />
1000<br />
2000<br />
-3 -1<br />
0 1 2<br />
Varianz K 2<br />
(m/s) 2<br />
10 20 30<br />
Durchmesser μ m<br />
Abbildung 5.8: Wirkung der Strahlungsabkuhlung auf das Teilchengro enspektrum. Die Gra ken<br />
sind in Matrixstruktur angeordnet. Die Zeilen beziehen sich auf die drei Regionen <strong>und</strong> die<br />
Spalten auf die Me werte. Im Vergleich <strong>zwischen</strong> Region 1 <strong>und</strong> 3 erkennt man einen deutlichen<br />
Unterschied in der Entwicklung der Wolken innerhalb der vorangegangenen 30 Minuten. Der<br />
Warmeverlust durch Strahlung fuhrt zur Neubildung <strong>und</strong> zum Wachstum von Tropfen.