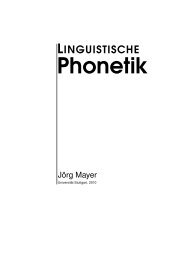Ein Computerlinguistisches Lexikon als komplexes System
Ein Computerlinguistisches Lexikon als komplexes System
Ein Computerlinguistisches Lexikon als komplexes System
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
4.2 <strong>Ein</strong>heiten und Prozesse in IA<br />
Modell der deutschen Morphologie 13 sind Derivationssuffixe Träger morphologischer<br />
Eigenschaften (vgl. Abschnitt 5.1.1). Dies erklärt, warum eine Derivation<br />
wie blumig (vgl. Zeile 8 in Abbildung 4.2) ein Adjektiv sein kann, obwohl die<br />
Basis substantivisch ist. Im Unterschied zu anderen morphologischen <strong>Ein</strong>heiten<br />
selegieren Affixe Basen nach deren morphologischen Eigenschaften (vgl. Lüdeling<br />
und Fitschen (2002) und ten Hacken und Lüdeling (2002)). Dies bedeutet<br />
insbesondere, dass die Derivation im Deutschen mit wesentlich restriktiveren<br />
Regeln <strong>als</strong> die Komposition beschrieben werden kann. Affixen kommt somit eine<br />
besondere Rolle in der Beschreibung von Wortbildungsprozessen zu.<br />
Außer <strong>als</strong> Suffixe treten Affixe im Deutschen <strong>als</strong> Präfixe und Zirkumfixe<br />
auf. Präfixe werden an die linke Seite einer Basis affigiert anstatt an die rechte.<br />
Sie beeinflussen im Gegensatz zu den Suffixen nicht die morphosyntaktischen<br />
Eigenschaften des Wortbildungsproduktes. 14 Dementsprechend gehören sie zu<br />
den morphologischen <strong>Ein</strong>heiten, die keiner Wortart angehören.<br />
Zirkumfixe bilden eine diskontinuierlich auftretende Kombination aus einem<br />
Präfix und einem Suffix. Das typische Muster ist die Nominalisierung von<br />
Verben mit dem Präfix Ge- und dem Suffix -e (Ge renn e, Ge heul e, Ge seufz e).<br />
Die Klassifizierung <strong>als</strong> Zirkumfix ergibt sich aus der Tatsache, dass keine der<br />
beiden möglichen Zerlegungen in unmittelbare Konstituenten (*Geseufz, *Seufze)<br />
belegt ist. Daher muss hier eine Wortbildung angenommen werden, bei der<br />
beide Affixe gleichzeitig an die Basis gehängt werden. Es handelt sich dabei um<br />
ein Klammerparadox (vgl. Spencer (1991), S. 397ff.). 15<br />
4.2.4 Zwischenkategorien<br />
Unter der Bezeichnung Zwischenkategorien werden hier morphologische <strong>Ein</strong>heiten<br />
beschrieben, die zwar durch ihr reihenbildendes Auftreten <strong>als</strong> eigenständige<br />
<strong>Ein</strong>heiten identifiziert werden können, aber nicht frei vorkommen und daher<br />
nur schwer einem Morphem zuzuordnen sind. Es handelt sich einerseits um die<br />
Affixoide, andererseits um die in Abschnitt 4.2.1 angesprochenen Unikale und<br />
Konfixe.<br />
13 Dieses Modell ist im Rahmen des DeKo-Projekts konzipiert worden, vgl. Abschnitt 5.1.<br />
14 Dies ist für eine Untermenge der Präfix- und Partikelverben im Deutschen umstritten: Ich<br />
teile die in Olsen (1991) vertretene Meinung, dass in diesen Fällen der Präfigierung eine Konversion<br />
der Basis vorweggeht. Neben den in Olsen (1991), S. 342ff., gegebenen Gegenargumenten<br />
scheint mir insbesondere der Gedanke plausibel zu sein, dass eine Konversion allein<br />
z.B. im Falle von feucht ¡ £¢¥¤ nach feuchten §¦ keine hinreichend gut unterscheidbare Form<br />
schafft: Das Resultat ist eine gebräuchliche Flexionsform des Adjektivs und damit von diesem<br />
nur schwer unterscheidbar. Erst das (nachfolgende) Hinzufügen eines Präfixes z.B. ermöglicht<br />
die eindeutige Unterscheidbarkeit.<br />
15 <strong>Ein</strong> Klammerparadox tritt auch bei anderen Phänomenen auf, beispielsweise bei der Kombination<br />
von Präfix- oder Partikelverben und Adjektivsuffixen (be ¡ schein ¡ ig(en), un ¡ aus ¡ weich ¡ lich)<br />
etc.<br />
55