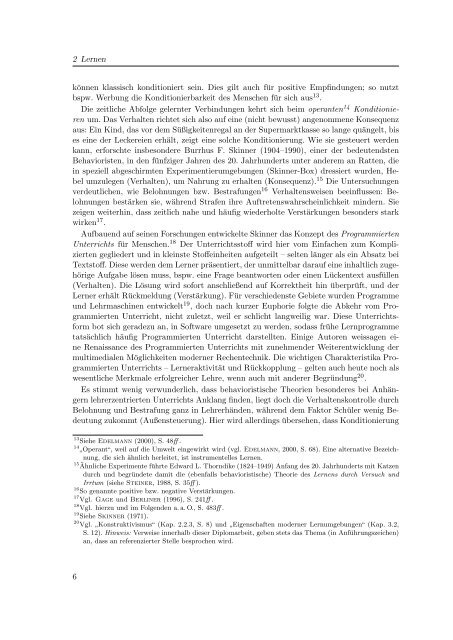Didaktische Konzepte hypermedialer Lernumgebungen: Umsetzung ...
Didaktische Konzepte hypermedialer Lernumgebungen: Umsetzung ...
Didaktische Konzepte hypermedialer Lernumgebungen: Umsetzung ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
2 Lernen<br />
können klassisch konditioniert sein. Dies gilt auch für positive Empfindungen; so nutzt<br />
bspw. Werbung die Konditionierbarkeit des Menschen für sich aus 13 .<br />
Die zeitliche Abfolge gelernter Verbindungen kehrt sich beim operanten 14 Konditionieren<br />
um. Das Verhalten richtet sich also auf eine (nicht bewusst) angenommene Konsequenz<br />
aus: Ein Kind, das vor dem Süßigkeitenregal an der Supermarktkasse so lange quängelt, bis<br />
es eine der Leckereien erhält, zeigt eine solche Konditionierung. Wie sie gesteuert werden<br />
kann, erforschte insbesondere Burrhus F. Skinner (1904–1990), einer der bedeutendsten<br />
Behavioristen, in den fünfziger Jahren des 20. Jahrhunderts unter anderem an Ratten, die<br />
in speziell abgeschirmten Experimentierumgebungen (Skinner-Box) dressiert wurden, Hebel<br />
umzulegen (Verhalten), um Nahrung zu erhalten (Konsequenz). 15 Die Untersuchungen<br />
verdeutlichen, wie Belohnungen bzw. Bestrafungen 16 Verhaltensweisen beeinflussen: Belohnungen<br />
bestärken sie, während Strafen ihre Auftretenswahrscheinlichkeit mindern. Sie<br />
zeigen weiterhin, dass zeitlich nahe und häufig wiederholte Verstärkungen besonders stark<br />
wirken 17 .<br />
Aufbauend auf seinen Forschungen entwickelte Skinner das Konzept des Programmierten<br />
Unterrichts für Menschen. 18 Der Unterrichtsstoff wird hier vom Einfachen zum Komplizierten<br />
gegliedert und in kleinste Stoffeinheiten aufgeteilt – selten länger als ein Absatz bei<br />
Textstoff. Diese werden dem Lerner präsentiert, der unmittelbar darauf eine inhaltlich zugehörige<br />
Aufgabe lösen muss, bspw. eine Frage beantworten oder einen Lückentext ausfüllen<br />
(Verhalten). Die Lösung wird sofort anschließend auf Korrektheit hin überprüft, und der<br />
Lerner erhält Rückmeldung (Verstärkung). Für verschiedenste Gebiete wurden Programme<br />
und Lehrmaschinen entwickelt 19 , doch nach kurzer Euphorie folgte die Abkehr vom Programmierten<br />
Unterricht, nicht zuletzt, weil er schlicht langweilig war. Diese Unterrichtsform<br />
bot sich geradezu an, in Software umgesetzt zu werden, sodass frühe Lernprogramme<br />
tatsächlich häufig Programmierten Unterricht darstellten. Einige Autoren weissagen eine<br />
Renaissance des Programmierten Unterrichts mit zunehmender Weiterentwicklung der<br />
multimedialen Möglichkeiten moderner Rechentechnik. Die wichtigen Charakteristika Programmierten<br />
Unterrichts – Lerneraktivität und Rückkopplung – gelten auch heute noch als<br />
wesentliche Merkmale erfolgreicher Lehre, wenn auch mit anderer Begründung 20 .<br />
Es stimmt wenig verwunderlich, dass behavioristische Theorien besonderes bei Anhängern<br />
lehrerzentrierten Unterrichts Anklang finden, liegt doch die Verhaltenskontrolle durch<br />
Belohnung und Bestrafung ganz in Lehrerhänden, während dem Faktor Schüler wenig Bedeutung<br />
zukommt (Außensteuerung). Hier wird allerdings übersehen, dass Konditionierung<br />
13<br />
Siehe Edelmann (2000), S. 48ff .<br />
14<br />
” Operant“, weil auf die Umwelt eingewirkt wird (vgl. Edelmann, 2000, S. 68). Eine alternative Bezeichnung,<br />
die sich ähnlich herleitet, ist instrumentelles Lernen.<br />
15<br />
Ähnliche Experimente führte Edward L. Thorndike (1824–1949) Anfang des 20. Jahrhunderts mit Katzen<br />
durch und begründete damit die (ebenfalls behavioristische) Theorie des Lernens durch Versuch und<br />
Irrtum (siehe Steiner, 1988, S. 35ff ).<br />
16<br />
So genannte positive bzw. negative Verstärkungen.<br />
17 Vgl. Gage und Berliner (1996), S. 241ff .<br />
18 Vgl. hierzu und im Folgenden a. a. O., S. 483ff .<br />
19 Siehe Skinner (1971).<br />
20 Vgl. ” Konstruktivismus“ (Kap. 2.2.3, S. 8) und ” Eigenschaften moderner <strong>Lernumgebungen</strong>“ (Kap. 3.2,<br />
S. 12). Hinweis: Verweise innerhalb dieser Diplomarbeit, geben stets das Thema (in Anführungszeichen)<br />
an, dass an referenzierter Stelle besprochen wird.<br />
6