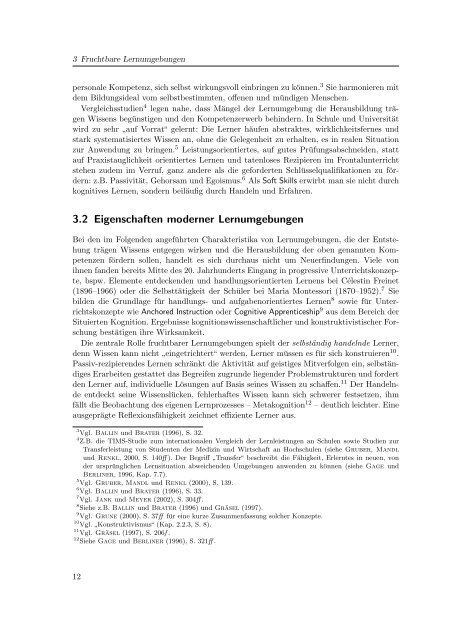Didaktische Konzepte hypermedialer Lernumgebungen: Umsetzung ...
Didaktische Konzepte hypermedialer Lernumgebungen: Umsetzung ...
Didaktische Konzepte hypermedialer Lernumgebungen: Umsetzung ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
3 Fruchtbare <strong>Lernumgebungen</strong><br />
personale Kompetenz, sich selbst wirkungsvoll einbringen zu können. 3 Sie harmonieren mit<br />
dem Bildungsideal vom selbstbestimmten, offenen und mündigen Menschen.<br />
Vergleichsstudien 4 legen nahe, dass Mängel der Lernumgebung die Herausbildung trägen<br />
Wissens begünstigen und den Kompetenzerwerb behindern. In Schule und Universität<br />
wird zu sehr ” auf Vorrat“ gelernt: Die Lerner häufen abstraktes, wirklichkeitsfernes und<br />
stark systematisiertes Wissen an, ohne die Gelegenheit zu erhalten, es in realen Situation<br />
zur Anwendung zu bringen. 5 Leistungsorientiertes, auf gutes Prüfungsabschneiden, statt<br />
auf Praxistauglichkeit orientiertes Lernen und tatenloses Rezipieren im Frontalunterricht<br />
stehen zudem im Verruf, ganz andere als die geforderten Schlüsselqualifikationen zu fördern:<br />
z.B. Passivität, Gehorsam und Egoismus. 6 Als Soft Skills erwirbt man sie nicht durch<br />
kognitives Lernen, sondern beiläufig durch Handeln und Erfahren.<br />
3.2 Eigenschaften moderner <strong>Lernumgebungen</strong><br />
Bei den im Folgenden angeführten Charakteristika von <strong>Lernumgebungen</strong>, die der Entstehung<br />
trägen Wissens entgegen wirken und die Herausbildung der oben genannten Kompetenzen<br />
fördern sollen, handelt es sich durchaus nicht um Neuerfindungen. Viele von<br />
ihnen fanden bereits Mitte des 20. Jahrhunderts Eingang in progressive Unterrichtskonzepte,<br />
bspw. Elemente entdeckenden und handlungsorientierten Lernens bei Célestin Freinet<br />
(1896–1966) oder die Selbsttätigkeit der Schüler bei Maria Montessori (1870–1952). 7 Sie<br />
bilden die Grundlage für handlungs- und aufgabenorientiertes Lernen 8 sowie für Unterrichtskonzepte<br />
wie Anchored Instruction oder Cognitive Apprenticeship 9 aus dem Bereich der<br />
Situierten Kognition. Ergebnisse kognitionswissenschaftlicher und konstruktivistischer Forschung<br />
bestätigen ihre Wirksamkeit.<br />
Die zentrale Rolle fruchtbarer <strong>Lernumgebungen</strong> spielt der selbständig handelnde Lerner,<br />
denn Wissen kann nicht ” eingetrichtert“ werden, Lerner müssen es für sich konstruieren 10 .<br />
Passiv-rezipierendes Lernen schränkt die Aktivität auf geistiges Mitverfolgen ein, selbständiges<br />
Erarbeiten gestattet das Begreifen zugrunde liegender Problemstrukturen und fordert<br />
den Lerner auf, individuelle Lösungen auf Basis seines Wissen zu schaffen. 11 Der Handelnde<br />
entdeckt seine Wissenslücken, fehlerhaftes Wissen kann sich schwerer festsetzen, ihm<br />
fällt die Beobachtung des eigenen Lernprozesses – Metakognition 12 – deutlich leichter. Eine<br />
ausgeprägte Reflexionsfähigkeit zeichnet effiziente Lerner aus.<br />
3<br />
Vgl. Ballin und Brater (1996), S. 32.<br />
4<br />
Z.B. die TIMS-Studie zum internationalen Vergleich der Lernleistungen an Schulen sowie Studien zur<br />
Transferleistung von Studenten der Medizin und Wirtschaft an Hochschulen (siehe Gruber, Mandl<br />
und Renkl, 2000, S. 140ff ). Der Begriff Transfer“ beschreibt die Fähigkeit, Erlerntes in neuen, von<br />
”<br />
der ursprünglichen Lernsituation abweichenden Umgebungen anwenden zu können (siehe Gage und<br />
Berliner, 1996, Kap. 7.7).<br />
5<br />
Vgl. Gruber, Mandl und Renkl (2000), S. 139.<br />
6<br />
Vgl. Ballin und Brater (1996), S. 33.<br />
7<br />
Vgl. Jank und Meyer (2002), S. 304ff .<br />
8<br />
Siehe z.B. Ballin und Brater (1996) und Gräsel (1997).<br />
9<br />
Vgl. Grune (2000), S. 37ff für eine kurze Zusammenfassung solcher <strong>Konzepte</strong>.<br />
10<br />
Vgl. Konstruktivismus“ (Kap. 2.2.3, S. 8).<br />
”<br />
11 Vgl. Gräsel (1997), S. 206f .<br />
12 Siehe Gage und Berliner (1996), S. 321ff .<br />
12