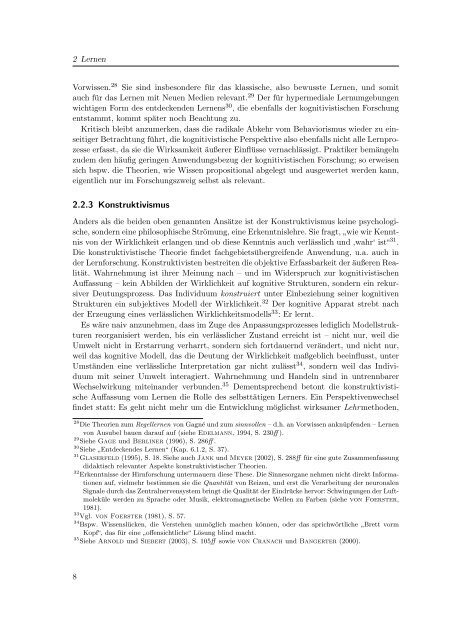Didaktische Konzepte hypermedialer Lernumgebungen: Umsetzung ...
Didaktische Konzepte hypermedialer Lernumgebungen: Umsetzung ...
Didaktische Konzepte hypermedialer Lernumgebungen: Umsetzung ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
2 Lernen<br />
Vorwissen. 28 Sie sind insbesondere für das klassische, also bewusste Lernen, und somit<br />
auch für das Lernen mit Neuen Medien relevant. 29 Der für hypermediale <strong>Lernumgebungen</strong><br />
wichtigen Form des entdeckenden Lernens 30 , die ebenfalls der kognitivistischen Forschung<br />
entstammt, kommt später noch Beachtung zu.<br />
Kritisch bleibt anzumerken, dass die radikale Abkehr vom Behaviorismus wieder zu einseitiger<br />
Betrachtung führt, die kognitivistische Perspektive also ebenfalls nicht alle Lernprozesse<br />
erfasst, da sie die Wirksamkeit äußerer Einflüsse vernachlässigt. Praktiker bemängeln<br />
zudem den häufig geringen Anwendungsbezug der kognitivistischen Forschung; so erweisen<br />
sich bspw. die Theorien, wie Wissen propositional abgelegt und ausgewertet werden kann,<br />
eigentlich nur im Forschungszweig selbst als relevant.<br />
2.2.3 Konstruktivismus<br />
Anders als die beiden oben genannten Ansätze ist der Konstruktivismus keine psychologische,<br />
sondern eine philosophische Strömung, eine Erkenntnislehre. Sie fragt, ” wie wir Kenntnis<br />
von der Wirklichkeit erlangen und ob diese Kenntnis auch verlässlich und ,wahr‘ ist“ 31 .<br />
Die konstruktivistische Theorie findet fachgebietsübergreifende Anwendung, u.a. auch in<br />
der Lernforschung. Konstruktivisten bestreiten die objektive Erfassbarkeit der äußeren Realität.<br />
Wahrnehmung ist ihrer Meinung nach – und im Widerspruch zur kognitivistischen<br />
Auffassung – kein Abbilden der Wirklichkeit auf kognitive Strukturen, sondern ein rekursiver<br />
Deutungsprozess. Das Individuum konstruiert unter Einbeziehung seiner kognitiven<br />
Strukturen ein subjektives Modell der Wirklichkeit. 32 Der kognitive Apparat strebt nach<br />
der Erzeugung eines verlässlichen Wirklichkeitsmodells 33 : Er lernt.<br />
Es wäre naiv anzunehmen, dass im Zuge des Anpassungsprozesses lediglich Modellstrukturen<br />
reorganisiert werden, bis ein verlässlicher Zustand erreicht ist – nicht nur, weil die<br />
Umwelt nicht in Erstarrung verharrt, sondern sich fortdauernd verändert, und nicht nur,<br />
weil das kognitive Modell, das die Deutung der Wirklichkeit maßgeblich beeinflusst, unter<br />
Umständen eine verlässliche Interpretation gar nicht zulässt 34 , sondern weil das Individuum<br />
mit seiner Umwelt interagiert. Wahrnehmung und Handeln sind in untrennbarer<br />
Wechselwirkung miteinander verbunden. 35 Dementsprechend betont die konstruktivistische<br />
Auffassung vom Lernen die Rolle des selbsttätigen Lerners. Ein Perspektivenwechsel<br />
findet statt: Es geht nicht mehr um die Entwicklung möglichst wirksamer Lehrmethoden,<br />
28<br />
Die Theorien zum Regellernen von Gagné und zum sinnvollen – d.h. an Vorwissen anknüpfenden – Lernen<br />
von Ausubel bauen darauf auf (siehe Edelmann, 1994, S. 230ff ).<br />
29<br />
Siehe Gage und Berliner (1996), S. 286ff .<br />
30<br />
Siehe Entdeckendes Lernen“ (Kap. 6.1.2, S. 37).<br />
31 ”<br />
Glaserfeld (1995), S. 18. Siehe auch Jank und Meyer (2002), S. 288ff für eine gute Zusammenfassung<br />
didaktisch relevanter Aspekte konstruktivistischer Theorien.<br />
32<br />
Erkenntnisse der Hirnforschung untermauern diese These. Die Sinnesorgane nehmen nicht direkt Informationen<br />
auf, vielmehr bestimmen sie die Quantität von Reizen, und erst die Verarbeitung der neuronalen<br />
Signale durch das Zentralnervensystem bringt die Qualität der Eindrücke hervor: Schwingungen der Luftmoleküle<br />
werden zu Sprache oder Musik, elektromagnetische Wellen zu Farben (siehe von Foerster,<br />
1981).<br />
33<br />
Vgl. von Foerster (1981), S. 57.<br />
34<br />
Bspw. Wissenslücken, die Verstehen unmöglich machen können, oder das sprichwörtliche Brett vorm<br />
”<br />
Kopf“, das für eine offensichtliche“ Lösung blind macht.<br />
35 ”<br />
Siehe Arnold und Siebert (2003), S. 105ff sowie von Cranach und Bangerter (2000).<br />
8