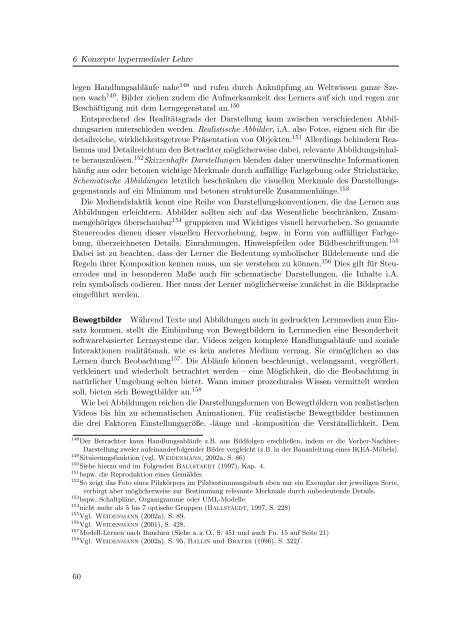Didaktische Konzepte hypermedialer Lernumgebungen: Umsetzung ...
Didaktische Konzepte hypermedialer Lernumgebungen: Umsetzung ...
Didaktische Konzepte hypermedialer Lernumgebungen: Umsetzung ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
6 <strong>Konzepte</strong> <strong>hypermedialer</strong> Lehre<br />
legen Handlungsabläufe nahe 148 und rufen durch Anknüpfung an Weltwissen ganze Szenen<br />
wach 149 . Bilder ziehen zudem die Aufmerksamkeit des Lerners auf sich und regen zur<br />
Beschäftigung mit dem Lerngegenstand an. 150<br />
Entsprechend des Realitätsgrads der Darstellung kann zwischen verschiedenen Abbildungsarten<br />
unterschieden werden. Realistische Abbilder, i.A. also Fotos, eignen sich für die<br />
detailreiche, wirklichkeitsgetreue Präsentation von Objekten. 151 Allerdings behindern Realismus<br />
und Detailreichtum den Betrachter möglicherweise dabei, relevante Abbildungsinhalte<br />
herauszulösen. 152 Skizzenhafte Darstellungen blenden daher unerwünschte Informationen<br />
häufig aus oder betonen wichtige Merkmale durch auffällige Farbgebung oder Strichstärke.<br />
Schematische Abbildungen letztlich beschränken die visuellen Merkmale des Darstellungsgegenstands<br />
auf ein Minimum und betonen strukturelle Zusammenhänge. 153<br />
Die Mediendidaktik kennt eine Reihe von Darstellungskonventionen, die das Lernen aus<br />
Abbildungen erleichtern. Abbilder sollten sich auf das Wesentliche beschränken, Zusammengehöriges<br />
überschaubar 154 gruppieren und Wichtiges visuell hervorheben. So genannte<br />
Steuercodes dienen dieser visuellen Hervorhebung, bspw. in Form von auffälliger Farbgebung,<br />
überzeichneten Details, Einrahmungen, Hinweispfeilen oder Bildbeschriftungen. 155<br />
Dabei ist zu beachten, dass der Lerner die Bedeutung symbolischer Bildelemente und die<br />
Regeln ihrer Komposition kennen muss, um sie verstehen zu können. 156 Dies gilt für Steuercodes<br />
und in besonderen Maße auch für schematische Darstellungen, die Inhalte i.A.<br />
rein symbolisch codieren. Hier muss der Lerner möglicherweise zunächst in die Bildsprache<br />
eingeführt werden.<br />
Bewegtbilder Während Texte und Abbildungen auch in gedruckten Lernmedien zum Einsatz<br />
kommen, stellt die Einbindung von Bewegtbildern in Lernmedien eine Besonderheit<br />
softwarebasierter Lernsysteme dar. Videos zeigen komplexe Handlungsabläufe und soziale<br />
Interaktionen realitätsnah, wie es kein anderes Medium vermag. Sie ermöglichen so das<br />
Lernen durch Beobachtung 157 . Die Abläufe können beschleunigt, verlangsamt, vergrößert,<br />
verkleinert und wiederholt betrachtet werden – eine Möglichkeit, die die Beobachtung in<br />
natürlicher Umgebung selten bietet. Wann immer prozedurales Wissen vermittelt werden<br />
soll, bieten sich Bewegtbilder an. 158<br />
Wie bei Abbildungen reichen die Darstellungsformen von Bewegtbildern von realistischen<br />
Videos bis hin zu schematischen Animationen. Für realistische Bewegtbilder bestimmen<br />
die drei Faktoren Einstellungsgröße, -länge und -komposition die Verständlichkeit. Dem<br />
148<br />
Der Betrachter kann Handlungsabläufe z.B. aus Bildfolgen erschließen, indem er die Vorher-Nachher-<br />
Darstellung zweier aufeinanderfolgender Bilder vergleicht (z.B. in der Bauanleitung eines IKEA-Möbels).<br />
149<br />
Situierungsfunktion (vgl. Weidenmann, 2002a, S. 86)<br />
150<br />
Siehe hierzu und im Folgenden Ballstaedt (1997), Kap. 4.<br />
151<br />
bspw. die Reproduktion eines Gemäldes<br />
152<br />
So zeigt das Foto eines Pilzkörpers im Pilzbestimmungsbuch eben nur ein Exemplar der jeweiligen Sorte,<br />
verbirgt aber möglicherweise zur Bestimmung relevante Merkmale durch unbedeutende Details.<br />
153<br />
bspw. Schaltpläne, Organigramme oder UML-Modelle<br />
154<br />
nicht mehr als 5 bis 7 optische Gruppen (Ballstaedt, 1997, S. 228)<br />
155<br />
Vgl. Weidenmann (2002a), S. 89.<br />
156<br />
Vgl. Weidenmann (2001), S. 428.<br />
157<br />
Modell-Lernen nach Bandura (Siehe a. a. O., S. 451 und auch Fn. 15 auf Seite 21)<br />
158<br />
Vgl. Weidenmann (2002a), S. 95, Ballin und Brater (1996), S. 322f .<br />
60