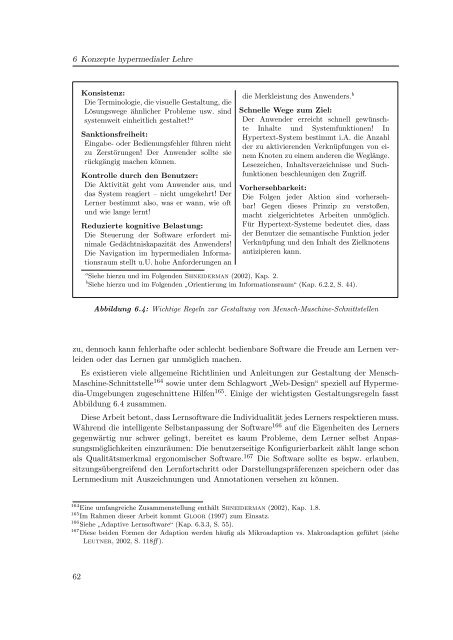Didaktische Konzepte hypermedialer Lernumgebungen: Umsetzung ...
Didaktische Konzepte hypermedialer Lernumgebungen: Umsetzung ...
Didaktische Konzepte hypermedialer Lernumgebungen: Umsetzung ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
6 <strong>Konzepte</strong> <strong>hypermedialer</strong> Lehre<br />
Konsistenz:<br />
Die Terminologie, die visuelle Gestaltung, die<br />
Lösungswege ähnlicher Probleme usw. sind<br />
systemweit einheitlich gestaltet! a<br />
Sanktionsfreiheit:<br />
Eingabe- oder Bedienungsfehler führen nicht<br />
zu Zerstörungen! Der Anwender sollte sie<br />
rückgängig machen können.<br />
Kontrolle durch den Benutzer:<br />
Die Aktivität geht vom Anwender aus, und<br />
das System reagiert – nicht umgekehrt! Der<br />
Lerner bestimmt also, was er wann, wie oft<br />
und wie lange lernt!<br />
Reduzierte kognitive Belastung:<br />
Die Steuerung der Software erfordert minimale<br />
Gedächtniskapazität des Anwenders!<br />
Die Navigation im hypermedialen Informationsraum<br />
stellt u.U. hohe Anforderungen an<br />
die Merkleistung des Anwenders. b<br />
Schnelle Wege zum Ziel:<br />
Der Anwender erreicht schnell gewünschte<br />
Inhalte und Systemfunktionen! In<br />
Hypertext-System bestimmt i.A. die Anzahl<br />
der zu aktivierenden Verknüpfungen von einem<br />
Knoten zu einem anderen die Weglänge.<br />
Lesezeichen, Inhaltsverzeichnisse und Suchfunktionen<br />
beschleunigen den Zugriff.<br />
Vorhersehbarkeit:<br />
Die Folgen jeder Aktion sind vorhersehbar!<br />
Gegen dieses Prinzip zu verstoßen,<br />
macht zielgerichtetes Arbeiten unmöglich.<br />
Für Hypertext-Systeme bedeutet dies, dass<br />
der Benutzer die semantische Funktion jeder<br />
Verknüpfung und den Inhalt des Zielknotens<br />
antizipieren kann.<br />
a Siehe hierzu und im Folgenden Shneiderman (2002), Kap. 2.<br />
b Siehe hierzu und im Folgenden ” Orientierung im Informationsraum“ (Kap. 6.2.2, S. 44).<br />
Abbildung 6.4: Wichtige Regeln zur Gestaltung von Mensch-Maschine-Schnittstellen<br />
zu, dennoch kann fehlerhafte oder schlecht bedienbare Software die Freude am Lernen verleiden<br />
oder das Lernen gar unmöglich machen.<br />
Es existieren viele allgemeine Richtlinien und Anleitungen zur Gestaltung der Mensch-<br />
Maschine-Schnittstelle 164 sowie unter dem Schlagwort ” Web-Design“ speziell auf Hypermedia-Umgebungen<br />
zugeschnittene Hilfen 165 . Einige der wichtigsten Gestaltungsregeln fasst<br />
Abbildung 6.4 zusammen.<br />
Diese Arbeit betont, dass Lernsoftware die Individualität jedes Lerners respektieren muss.<br />
Während die intelligente Selbstanpassung der Software 166 auf die Eigenheiten des Lerners<br />
gegenwärtig nur schwer gelingt, bereitet es kaum Probleme, dem Lerner selbst Anpassungsmöglichkeiten<br />
einzuräumen: Die benutzerseitige Konfigurierbarkeit zählt lange schon<br />
als Qualitätsmerkmal ergonomischer Software. 167 Die Software sollte es bspw. erlauben,<br />
sitzungsübergreifend den Lernfortschritt oder Darstellungspräferenzen speichern oder das<br />
Lernmedium mit Auszeichnungen und Annotationen versehen zu können.<br />
164 Eine umfangreiche Zusammenstellung enthält Shneiderman (2002), Kap. 1.8.<br />
165 Im Rahmen dieser Arbeit kommt Gloor (1997) zum Einsatz.<br />
166 Siehe ” Adaptive Lernsoftware“ (Kap. 6.3.3, S. 55).<br />
167 Diese beiden Formen der Adaption werden häufig als Mikroadaption vs. Makroadaption geführt (siehe<br />
62<br />
Leutner, 2002, S. 118ff ).