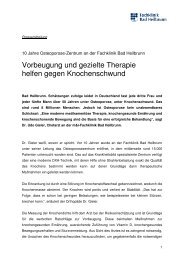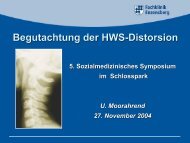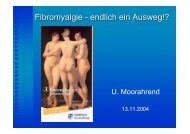Fibromyalgie â endlich ein Ausweg - m&i-Klinikgruppe Enzensberg
Fibromyalgie â endlich ein Ausweg - m&i-Klinikgruppe Enzensberg
Fibromyalgie â endlich ein Ausweg - m&i-Klinikgruppe Enzensberg
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Manfred Ruoß, Kerstin Harrabi Entspannung, Imagination, Biofeedback<br />
gungen der Kontrollierbarkeit des Schmerzes und damit der Selbstwirksamkeit. Imaginative<br />
Techniken haben in der psychologischen Schmerztherapie als ergänzende Verfahren <strong>ein</strong>en<br />
wichtigen Stellenwert.<br />
2.4 Biofeedback<br />
Biofeedback ist definiert als <strong>ein</strong> Vorgang, bei dem <strong>ein</strong>e Person lernt, physiologische Prozesse<br />
zu be<strong>ein</strong>flussen. Dies betrifft sowohl solche Prozesse, die üblicherweise nicht unter willentlicher<br />
Kontrolle stehen (z. B. Körpertemperatur, Hautleitfähigkeit), als auch solche physiologischen<br />
Prozesse, die üblicherweise bewusst zu regulieren sind (z. B. Muskelspannung),<br />
bei denen jedoch die Regulation zusammengebrochen ist (sogenannte funktionelle Störungen).<br />
Bei jeder Form von Biofeedback sind drei Operationen zu unterscheiden:<br />
1. Erfassen und verstärken biologischer Responses/Prozesse<br />
2. Umwandlung der bioelektrischen Signale, meist in visuelle oder akustische Form<br />
3. Unmittelbares („Echtzeit“) Feedback des Funktionszustandes des gemessenen<br />
physiologischen Systems<br />
Von vielen Autoren (Rief & Birbaumer, 2000) wird Biofeedback als sehr effektive Intervention<br />
bei chronischen Schmerzsyndromen empfohlen. K<strong>ein</strong>e endgültige Klarheit besteht über die<br />
Wirkmechanismen. Man kann zwei Rahmentheorien unterscheiden (Kröner-Herwig, 2004).<br />
Ein theoretischer Ansatz nimmt primär physiologische Wirkmechanismen an, der andere<br />
geht von primär kognitiven Wirkmechanismen aus.<br />
Bei physiologischen Wirkmechanismen wird unterschieden zwischen <strong>ein</strong>em physiologischen<br />
Spezifitätsmodell (der Proband erwirbt die Fähigkeit der physiologischen Selbstkontrolle über<br />
die spezifische rückgemeldete, pathophysiologisch relevante Funktion wie beispielsweise<br />
Muskeltonus oder Herzrate) und <strong>ein</strong>em unspezifischen physiologischen Wirkmodell (der<br />
physiologische Effekt ist genereller Art und wird auf dem Weg <strong>ein</strong>er allgem<strong>ein</strong>en Entspannung<br />
erreicht).<br />
Bei kognitiven Erklärungsansätzen werden ebenfalls zwei mögliche Wirkmechanismen diskutiert.<br />
Man kann annehmen, dass die Feedbackintervention beim Probanden wichtige Einstellungs-<br />
und Erwartungsänderungen bewirkt. Der Proband erkennt, dass er s<strong>ein</strong>e Symptome<br />
verändern kann und erfährt dadurch <strong>ein</strong>e Steigerung s<strong>ein</strong>er Selbstwirksamkeitsüberzeugungen.<br />
Für das konkrete Vorgehen bedeutet dies, so mit <strong>ein</strong>em Patienten zu arbeiten, dass<br />
dieser möglichst viel Erfolg und Kontrolle erlebt. Der zweite kognitive Erklärungsansatz postuliert<br />
<strong>ein</strong>e Verbesserung der Interozeption durch Biofeedback, also <strong>ein</strong>er Veränderung der<br />
Körper- und Selbstwahrnehmung. Es ergeben sich damit vier mögliche Wirkmechanismen:<br />
� Veränderung spezifischer pathophysiologischer Funktionszustände<br />
� Aufbau <strong>ein</strong>er spezifischen oder allgem<strong>ein</strong>en Entspannungskompetenz<br />
� Steigerung von Selbstwirksamkeitsüberzeugungen<br />
� Verbesserung der Interozeption<br />
m&i-Fachklinik <strong>Enzensberg</strong> | Interdisziplinäres Schmerzzentrum<br />
99