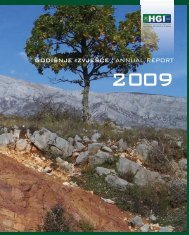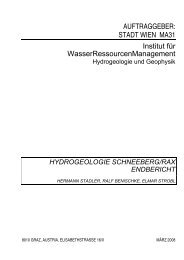Final Report - KATER
Final Report - KATER
Final Report - KATER
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Gefährdungspotentiale von Quellschutzgebieten infolge touristischer Nutzung<br />
5.6 Wasserhaushalt – Karstproblematik<br />
Durch den Aufbau aus verkarstungsfähigen Gesteinen (Kalk und Dolomit, siehe Kap. 'Geologie') ist<br />
die Oberfläche der Rax (ebenso wie Schneeberg, Schneealpe und Hochschwab) von einem dichten<br />
Netz an Klüften und Rissen überzogen. Diese Systeme aus Klüften und Schichtfugen reichen tief in<br />
das Berginnere hinein und durchziehen den gesamten Gebirgsstock, wobei die Größe von kleinen<br />
Fugen bis zu ausgedehnten Höhlensystemen reichen kann.<br />
Im Gegensatz zu den meisten Gebieten mit kristallinem Untergrund, wo ein Großteil des Abflusses<br />
oberirdisch erfolgt, sickert das Wasser im Karst sehr rasch in den Untergrund. (Dies erklärt auch,<br />
warum es auf der Rax keinerlei Oberflächengewässer gibt und warum auf der Hochfläche trotz der<br />
Höhenlage und einer Niederschlagsmenge von ca. 2.000 mm im Jahr akuter Wassermangel<br />
herrscht). Das mit CO 2 angereicherte Wasser löst das Gestein mit den darin enthaltenen<br />
Mineralien, durchfließt die vadose Zone (ungesättigte Zone), bis es sich über einer<br />
wasserstauenden Schicht (hier Werfener Schichten, siehe Kap. 'Geologie') ansammelt; die<br />
wassergesättigte Zone wird auch phreatische Zone genannt.<br />
Wird diese wassergesättigte Schicht irgendwo von einem Tal angeschnitten, treten die Karstwässer<br />
in Form von (meist einigen wenigen) Quellen wieder an die Oberfläche. Da die Werfener Schichten<br />
von Süden nach Norden hin abfallen, sind die meisten bzw. ergiebigsten Quellen im Nordwesten<br />
bzw. Nordosten der Rax vorzufinden. Im Süden dagegen findet man nur einige kümmerliche<br />
Wasseraustritte (z.B. Reißtalerquelle) bzw. Schuttquellen, wenn sich das Wasser unter dem<br />
aufgelagerten Schutt bzw. oberflächlich aufgelockertem Gestein über einem nicht oder nur schwer<br />
durchlässigen Horizont sammelt, wie die Emmaquelle am Preiner Gscheid (CORNELIUS, 1936).<br />
Die Verweildauer des Wassers im Gestein (d.h. die Dauer vom Einsickern an der Oberfläche bis<br />
zum Quellaustritt) ist sehr unterschiedlich. Sie reicht von wenigen Stunden bis zu vielen Jahren,<br />
wobei es natürlich auch gesteinsabhängige Unterschiede gibt. Auch die Schüttungsverhältnisse<br />
werden sehr stark von den anstehenden Gesteinen bestimmt. Die Verweildauer ist darüber hinaus<br />
auch von folgenden Faktoren abhängig:<br />
• Klüftigkeit<br />
• Mächtigkeit des anstehenden Gesteins<br />
• Boden (Art, Zusammensetzung und Mächtigkeit)<br />
• Vegetationsauflage (Art, Dichte, Durchwurzelungsintensität und Höhe)<br />
So ist Kalk eher grob geklüftet, mit einem überwiegend senkrecht ausgerichteten Kluftsystem. Das<br />
Wasser fließt relativ rasch durch das Gestein, Kalkquellen reagieren auf Niederschlagsereignisse<br />
zumeist sehr kurzfristig, sie 'springen' sehr rasch an und ebben auch relativ rasch wieder ab.<br />
Dolomit dagegen ist feiner geklüftet und hat demnach nicht so eine starke Wassergängigkeit wie<br />
Kalkgestein. Insgesamt ist aber das Speichervermögen in der Regel aber größer, das Wasser fließt<br />
ständig und viel gleichmäßiger.<br />
Ein Beispiel:<br />
• Die Kläfferquelle (Kalk) hat in Spitzenzeiten eine Schüttung von bis zu 10.000 m 3 /Sekunde,<br />
in Trockenperioden sinkt die Schüttungsmenge auf ca. 600 m 3 /Sekunde. Das Verhältnis<br />
Maximal- zu Minimalschüttung beträgt ca. 16:1.<br />
Seite 59