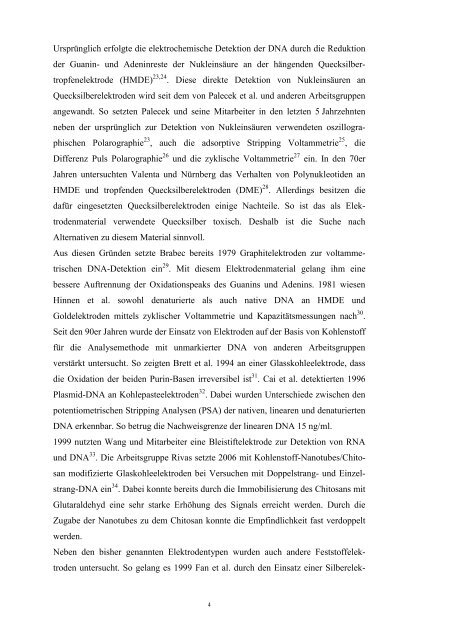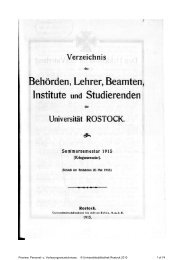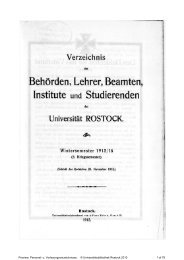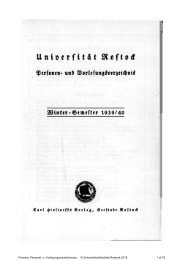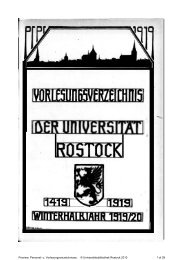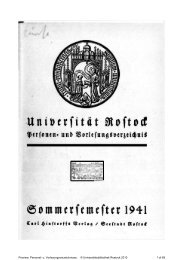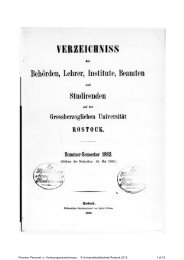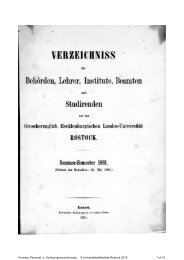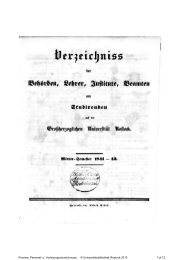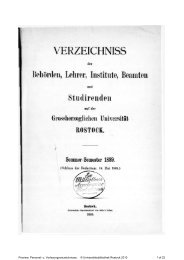Archivserver der Deutschen Nationalbibliothek
Archivserver der Deutschen Nationalbibliothek
Archivserver der Deutschen Nationalbibliothek
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Ursprünglich erfolgte die elektrochemische Detektion <strong>der</strong> DNA durch die Reduktion<br />
<strong>der</strong> Guanin- und Adeninreste <strong>der</strong> Nukleinsäure an <strong>der</strong> hängenden Quecksilbertropfenelektrode<br />
(HMDE) 23,24 . Diese direkte Detektion von Nukleinsäuren an<br />
Quecksilberelektroden wird seit dem von Palecek et al. und an<strong>der</strong>en Arbeitsgruppen<br />
angewandt. So setzten Palecek und seine Mitarbeiter in den letzten 5 Jahrzehnten<br />
neben <strong>der</strong> ursprünglich zur Detektion von Nukleinsäuren verwendeten oszillographischen<br />
Polarographie 23 , auch die adsorptive Stripping Voltammetrie 25 , die<br />
Differenz Puls Polarographie 26 und die zyklische Voltammetrie 27 ein. In den 70er<br />
Jahren untersuchten Valenta und Nürnberg das Verhalten von Polynukleotiden an<br />
HMDE und tropfenden Quecksilberelektroden (DME) 28 . Allerdings besitzen die<br />
dafür eingesetzten Quecksilberelektroden einige Nachteile. So ist das als Elektrodenmaterial<br />
verwendete Quecksilber toxisch. Deshalb ist die Suche nach<br />
Alternativen zu diesem Material sinnvoll.<br />
Aus diesen Gründen setzte Brabec bereits 1979 Graphitelektroden zur voltammetrischen<br />
DNA-Detektion ein 29 . Mit diesem Elektrodenmaterial gelang ihm eine<br />
bessere Auftrennung <strong>der</strong> Oxidationspeaks des Guanins und Adenins. 1981 wiesen<br />
Hinnen et al. sowohl denaturierte als auch native DNA an HMDE und<br />
Goldelektroden mittels zyklischer Voltammetrie und Kapazitätsmessungen nach 30 .<br />
Seit den 90er Jahren wurde <strong>der</strong> Einsatz von Elektroden auf <strong>der</strong> Basis von Kohlenstoff<br />
für die Analysemethode mit unmarkierter DNA von an<strong>der</strong>en Arbeitsgruppen<br />
verstärkt untersucht. So zeigten Brett et al. 1994 an einer Glasskohleelektrode, dass<br />
die Oxidation <strong>der</strong> beiden Purin-Basen irreversibel ist 31 . Cai et al. detektierten 1996<br />
Plasmid-DNA an Kohlepasteelektroden 32 . Dabei wurden Unterschiede zwischen den<br />
potentiometrischen Stripping Analysen (PSA) <strong>der</strong> nativen, linearen und denaturierten<br />
DNA erkennbar. So betrug die Nachweisgrenze <strong>der</strong> linearen DNA 15 ng/ml.<br />
1999 nutzten Wang und Mitarbeiter eine Bleistiftelektrode zur Detektion von RNA<br />
und DNA 33 . Die Arbeitsgruppe Rivas setzte 2006 mit Kohlenstoff-Nanotubes/Chitosan<br />
modifizierte Glaskohleelektroden bei Versuchen mit Doppelstrang- und Einzelstrang-DNA<br />
ein 34 . Dabei konnte bereits durch die Immobilisierung des Chitosans mit<br />
Glutaraldehyd eine sehr starke Erhöhung des Signals erreicht werden. Durch die<br />
Zugabe <strong>der</strong> Nanotubes zu dem Chitosan konnte die Empfindlichkeit fast verdoppelt<br />
werden.<br />
Neben den bisher genannten Elektrodentypen wurden auch an<strong>der</strong>e Feststoffelektroden<br />
untersucht. So gelang es 1999 Fan et al. durch den Einsatz einer Silberelek-<br />
4