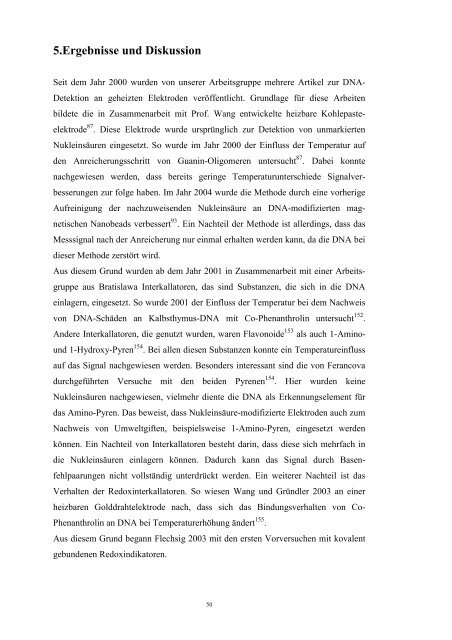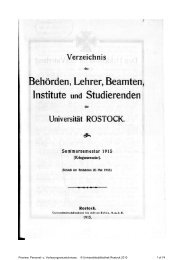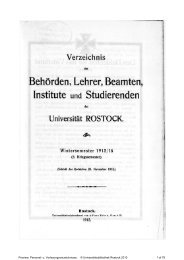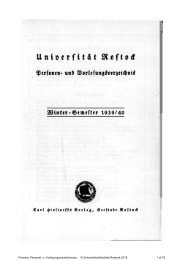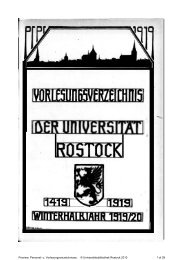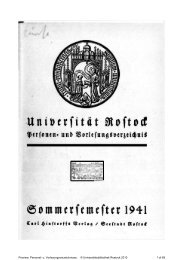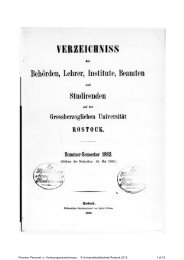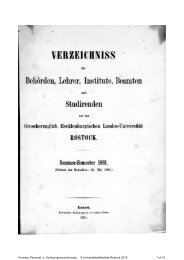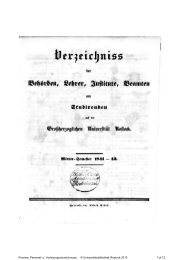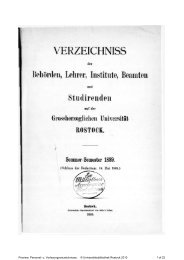Archivserver der Deutschen Nationalbibliothek
Archivserver der Deutschen Nationalbibliothek
Archivserver der Deutschen Nationalbibliothek
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
5.Ergebnisse und Diskussion<br />
Seit dem Jahr 2000 wurden von unserer Arbeitsgruppe mehrere Artikel zur DNA-<br />
Detektion an geheizten Elektroden veröffentlicht. Grundlage für diese Arbeiten<br />
bildete die in Zusammenarbeit mit Prof. Wang entwickelte heizbare Kohlepasteelektrode<br />
87 . Diese Elektrode wurde ursprünglich zur Detektion von unmarkierten<br />
Nukleinsäuren eingesetzt. So wurde im Jahr 2000 <strong>der</strong> Einfluss <strong>der</strong> Temperatur auf<br />
den Anreicherungsschritt von Guanin-Oligomeren untersucht 87 . Dabei konnte<br />
nachgewiesen werden, dass bereits geringe Temperaturunterschiede Signalverbesserungen<br />
zur folge haben. Im Jahr 2004 wurde die Methode durch eine vorherige<br />
Aufreinigung <strong>der</strong> nachzuweisenden Nukleinsäure an DNA-modifizierten magnetischen<br />
Nanobeads verbessert 93 . Ein Nachteil <strong>der</strong> Methode ist allerdings, dass das<br />
Messsignal nach <strong>der</strong> Anreicherung nur einmal erhalten werden kann, da die DNA bei<br />
dieser Methode zerstört wird.<br />
Aus diesem Grund wurden ab dem Jahr 2001 in Zusammenarbeit mit einer Arbeitsgruppe<br />
aus Bratislawa Interkallatoren, das sind Substanzen, die sich in die DNA<br />
einlagern, eingesetzt. So wurde 2001 <strong>der</strong> Einfluss <strong>der</strong> Temperatur bei dem Nachweis<br />
von DNA-Schäden an Kalbsthymus-DNA mit Co-Phenanthrolin untersucht 152 .<br />
An<strong>der</strong>e Interkallatoren, die genutzt wurden, waren Flavonoide 153 als auch 1-Aminound<br />
1-Hydroxy-Pyren 154 . Bei allen diesen Substanzen konnte ein Temperatureinfluss<br />
auf das Signal nachgewiesen werden. Beson<strong>der</strong>s interessant sind die von Ferancova<br />
durchgeführten Versuche mit den beiden Pyrenen 154 . Hier wurden keine<br />
Nukleinsäuren nachgewiesen, vielmehr diente die DNA als Erkennungselement für<br />
das Amino-Pyren. Das beweist, dass Nukleinsäure-modifizierte Elektroden auch zum<br />
Nachweis von Umweltgiften, beispielsweise 1-Amino-Pyren, eingesetzt werden<br />
können. Ein Nachteil von Interkallatoren besteht darin, dass diese sich mehrfach in<br />
die Nukleinsäuren einlagern können. Dadurch kann das Signal durch Basenfehlpaarungen<br />
nicht vollständig unterdrückt werden. Ein weiterer Nachteil ist das<br />
Verhalten <strong>der</strong> Redoxinterkallatoren. So wiesen Wang und Gründler 2003 an einer<br />
heizbaren Golddrahtelektrode nach, dass sich das Bindungsverhalten von Co-<br />
Phenanthrolin an DNA bei Temperaturerhöhung än<strong>der</strong>t 155 .<br />
Aus diesem Grund begann Flechsig 2003 mit den ersten Vorversuchen mit kovalent<br />
gebundenen Redoxindikatoren.<br />
50