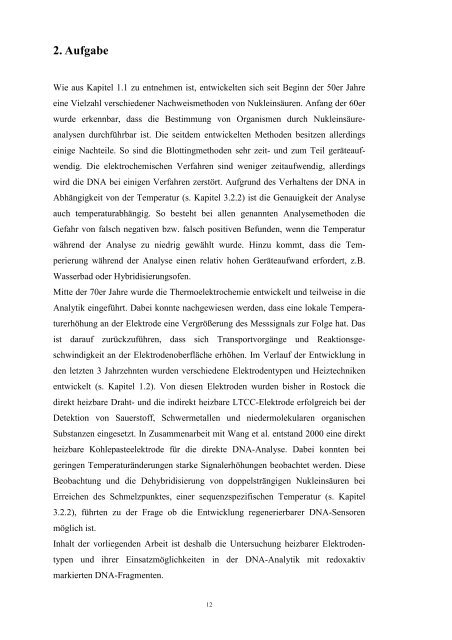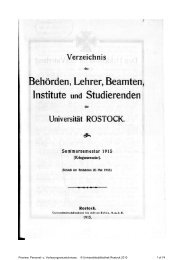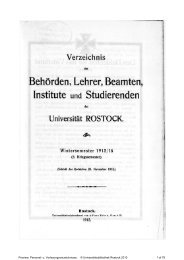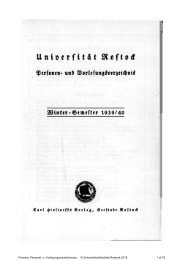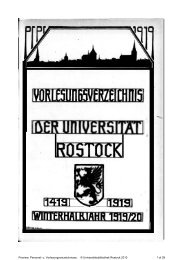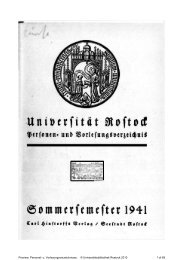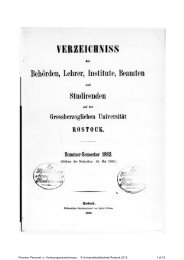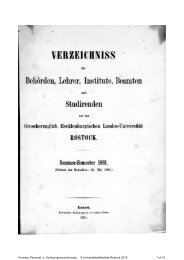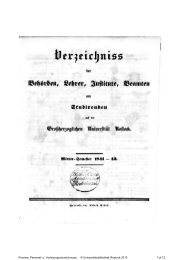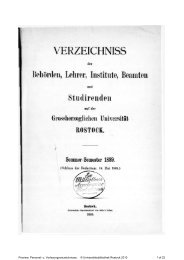Archivserver der Deutschen Nationalbibliothek
Archivserver der Deutschen Nationalbibliothek
Archivserver der Deutschen Nationalbibliothek
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
2. Aufgabe<br />
Wie aus Kapitel 1.1 zu entnehmen ist, entwickelten sich seit Beginn <strong>der</strong> 50er Jahre<br />
eine Vielzahl verschiedener Nachweismethoden von Nukleinsäuren. Anfang <strong>der</strong> 60er<br />
wurde erkennbar, dass die Bestimmung von Organismen durch Nukleinsäureanalysen<br />
durchführbar ist. Die seitdem entwickelten Methoden besitzen allerdings<br />
einige Nachteile. So sind die Blottingmethoden sehr zeit- und zum Teil geräteaufwendig.<br />
Die elektrochemischen Verfahren sind weniger zeitaufwendig, allerdings<br />
wird die DNA bei einigen Verfahren zerstört. Aufgrund des Verhaltens <strong>der</strong> DNA in<br />
Abhängigkeit von <strong>der</strong> Temperatur (s. Kapitel 3.2.2) ist die Genauigkeit <strong>der</strong> Analyse<br />
auch temperaturabhängig. So besteht bei allen genannten Analysemethoden die<br />
Gefahr von falsch negativen bzw. falsch positiven Befunden, wenn die Temperatur<br />
während <strong>der</strong> Analyse zu niedrig gewählt wurde. Hinzu kommt, dass die Temperierung<br />
während <strong>der</strong> Analyse einen relativ hohen Geräteaufwand erfor<strong>der</strong>t, z.B.<br />
Wasserbad o<strong>der</strong> Hybridisierungsofen.<br />
Mitte <strong>der</strong> 70er Jahre wurde die Thermoelektrochemie entwickelt und teilweise in die<br />
Analytik eingeführt. Dabei konnte nachgewiesen werden, dass eine lokale Temperaturerhöhung<br />
an <strong>der</strong> Elektrode eine Vergrößerung des Messsignals zur Folge hat. Das<br />
ist darauf zurückzuführen, dass sich Transportvorgänge und Reaktionsgeschwindigkeit<br />
an <strong>der</strong> Elektrodenoberfläche erhöhen. Im Verlauf <strong>der</strong> Entwicklung in<br />
den letzten 3 Jahrzehnten wurden verschiedene Elektrodentypen und Heiztechniken<br />
entwickelt (s. Kapitel 1.2). Von diesen Elektroden wurden bisher in Rostock die<br />
direkt heizbare Draht- und die indirekt heizbare LTCC-Elektrode erfolgreich bei <strong>der</strong><br />
Detektion von Sauerstoff, Schwermetallen und nie<strong>der</strong>molekularen organischen<br />
Substanzen eingesetzt. In Zusammenarbeit mit Wang et al. entstand 2000 eine direkt<br />
heizbare Kohlepasteelektrode für die direkte DNA-Analyse. Dabei konnten bei<br />
geringen Temperaturän<strong>der</strong>ungen starke Signalerhöhungen beobachtet werden. Diese<br />
Beobachtung und die Dehybridisierung von doppelsträngigen Nukleinsäuren bei<br />
Erreichen des Schmelzpunktes, einer sequenzspezifischen Temperatur (s. Kapitel<br />
3.2.2), führten zu <strong>der</strong> Frage ob die Entwicklung regenerierbarer DNA-Sensoren<br />
möglich ist.<br />
Inhalt <strong>der</strong> vorliegenden Arbeit ist deshalb die Untersuchung heizbarer Elektrodentypen<br />
und ihrer Einsatzmöglichkeiten in <strong>der</strong> DNA-Analytik mit redoxaktiv<br />
markierten DNA-Fragmenten.<br />
12