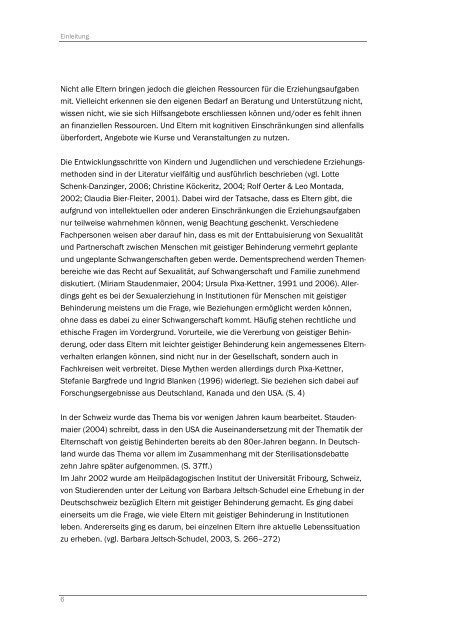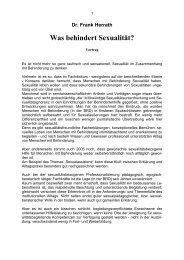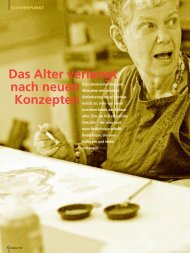Herunterladen PDF - Insieme
Herunterladen PDF - Insieme
Herunterladen PDF - Insieme
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Einleitung<br />
Nicht alle Eltern bringen jedoch die gleichen Ressourcen für die Erziehungsaufgaben<br />
mit. Vielleicht erkennen sie den eigenen Bedarf an Beratung und Unterstützung nicht,<br />
wissen nicht, wie sie sich Hilfsangebote erschliessen können und/oder es fehlt ihnen<br />
an finanziellen Ressourcen. Und Eltern mit kognitiven Einschränkungen sind allenfalls<br />
überfordert, Angebote wie Kurse und Veranstaltungen zu nutzen.<br />
Die Entwicklungsschritte von Kindern und Jugendlichen und verschiedene Erziehungs-<br />
methoden sind in der Literatur vielfältig und ausführlich beschrieben (vgl. Lotte<br />
Schenk-Danzinger, 2006; Christine Köckeritz, 2004; Rolf Oerter & Leo Montada,<br />
2002; Claudia Bier-Fleiter, 2001). Dabei wird der Tatsache, dass es Eltern gibt, die<br />
aufgrund von intellektuellen oder anderen Einschränkungen die Erziehungsaufgaben<br />
nur teilweise wahrnehmen können, wenig Beachtung geschenkt. Verschiedene<br />
Fachpersonen weisen aber darauf hin, dass es mit der Enttabuisierung von Sexualität<br />
und Partnerschaft zwischen Menschen mit geistiger Behinderung vermehrt geplante<br />
und ungeplante Schwangerschaften geben werde. Dementsprechend werden Themen-<br />
bereiche wie das Recht auf Sexualität, auf Schwangerschaft und Familie zunehmend<br />
diskutiert. (Miriam Staudenmaier, 2004; Ursula Pixa-Kettner, 1991 und 2006). Aller-<br />
dings geht es bei der Sexualerziehung in Institutionen für Menschen mit geistiger<br />
Behinderung meistens um die Frage, wie Beziehungen ermöglicht werden können,<br />
ohne dass es dabei zu einer Schwangerschaft kommt. Häufig stehen rechtliche und<br />
ethische Fragen im Vordergrund. Vorurteile, wie die Vererbung von geistiger Behin-<br />
derung, oder dass Eltern mit leichter geistiger Behinderung kein angemessenes Eltern-<br />
verhalten erlangen können, sind nicht nur in der Gesellschaft, sondern auch in<br />
Fachkreisen weit verbreitet. Diese Mythen werden allerdings durch Pixa-Kettner,<br />
Stefanie Bargfrede und Ingrid Blanken (1996) widerlegt. Sie beziehen sich dabei auf<br />
Forschungsergebnisse aus Deutschland, Kanada und den USA. (S. 4)<br />
In der Schweiz wurde das Thema bis vor wenigen Jahren kaum bearbeitet. Stauden-<br />
maier (2004) schreibt, dass in den USA die Auseinandersetzung mit der Thematik der<br />
Elternschaft von geistig Behinderten bereits ab den 80er-Jahren begann. In Deutsch-<br />
land wurde das Thema vor allem im Zusammenhang mit der Sterilisationsdebatte<br />
zehn Jahre später aufgenommen. (S. 37ff.)<br />
Im Jahr 2002 wurde am Heilpädagogischen Institut der Universität Fribourg, Schweiz,<br />
von Studierenden unter der Leitung von Barbara Jeltsch-Schudel eine Erhebung in der<br />
Deutschschweiz bezüglich Eltern mit geistiger Behinderung gemacht. Es ging dabei<br />
einerseits um die Frage, wie viele Eltern mit geistiger Behinderung in Institutionen<br />
leben. Andererseits ging es darum, bei einzelnen Eltern ihre aktuelle Lebenssituation<br />
zu erheben. (vgl. Barbara Jeltsch-Schudel, 2003, S. 266–272)<br />
6