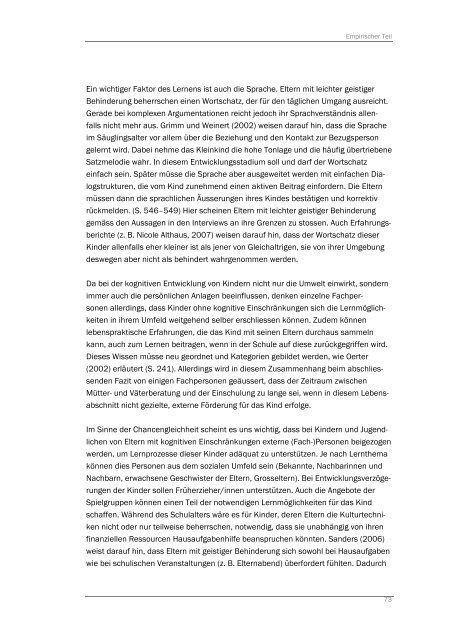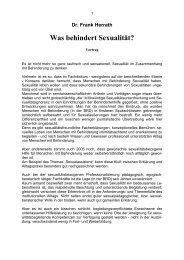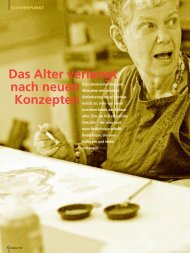Herunterladen PDF - Insieme
Herunterladen PDF - Insieme
Herunterladen PDF - Insieme
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Empirischer Teil<br />
Ein wichtiger Faktor des Lernens ist auch die Sprache. Eltern mit leichter geistiger<br />
Behinderung beherrschen einen Wortschatz, der für den täglichen Umgang ausreicht.<br />
Gerade bei komplexen Argumentationen reicht jedoch ihr Sprachverständnis allen-<br />
falls nicht mehr aus. Grimm und Weinert (2002) weisen darauf hin, dass die Sprache<br />
im Säuglingsalter vor allem über die Beziehung und den Kontakt zur Bezugsperson<br />
gelernt wird. Dabei nehme das Kleinkind die hohe Tonlage und die häufig übertriebene<br />
Satzmelodie wahr. In diesem Entwicklungsstadium soll und darf der Wortschatz<br />
einfach sein. Später müsse die Sprache aber ausgeweitet werden mit einfachen Dia-<br />
logstrukturen, die vom Kind zunehmend einen aktiven Beitrag einfordern. Die Eltern<br />
müssen dann die sprachlichen Äusserungen ihres Kindes bestätigen und korrektiv<br />
rückmelden. (S. 546–549) Hier scheinen Eltern mit leichter geistiger Behinderung<br />
gemäss den Aussagen in den Interviews an ihre Grenzen zu stossen. Auch Erfahrungs-<br />
berichte (z. B. Nicole Althaus, 2007) weisen darauf hin, dass der Wortschatz dieser<br />
Kinder allenfalls eher kleiner ist als jener von Gleichaltrigen, sie von ihrer Umgebung<br />
deswegen aber nicht als behindert wahrgenommen werden.<br />
Da bei der kognitiven Entwicklung von Kindern nicht nur die Umwelt einwirkt, sondern<br />
immer auch die persönlichen Anlagen beeinflussen, denken einzelne Fachper-<br />
sonen allerdings, dass Kinder ohne kognitive Einschränkungen sich die Lernmöglich-<br />
keiten in ihrem Umfeld weitgehend selber erschliessen können. Zudem können<br />
lebenspraktische Erfahrungen, die das Kind mit seinen Eltern durchaus sammeln<br />
kann, auch zum Lernen beitragen, wenn in der Schule auf diese zurückgegriffen wird.<br />
Dieses Wissen müsse neu geordnet und Kategorien gebildet werden, wie Oerter<br />
(2002) erläutert (S. 241). Allerdings wird in diesem Zusammenhang beim abschlies-<br />
senden Fazit von einigen Fachpersonen geäussert, dass der Zeitraum zwischen<br />
Mütter- und Väterberatung und der Einschulung zu lange sei, wenn in diesem Lebens-<br />
abschnitt nicht gezielte, externe Förderung für das Kind erfolge.<br />
Im Sinne der Chancengleichheit scheint es uns wichtig, dass bei Kindern und Jugend-<br />
lichen von Eltern mit kognitiven Einschränkungen externe (Fach-)Personen beigezogen<br />
werden, um Lernprozesse dieser Kinder adäquat zu unterstützen. Je nach Lernthema<br />
können dies Personen aus dem sozialen Umfeld sein (Bekannte, Nachbarinnen und<br />
Nachbarn, erwachsene Geschwister der Eltern, Grosseltern). Bei Entwicklungsverzöge-<br />
rungen der Kinder sollen Früherzieher/innen unterstützen. Auch die Angebote der<br />
Spielgruppen können einen Teil der notwendigen Lernmöglichkeiten für das Kind<br />
schaffen. Während des Schulalters wäre es für Kinder, deren Eltern die Kulturtechni-<br />
ken nicht oder nur teilweise beherrschen, notwendig, dass sie unabhängig von ihren<br />
finanziellen Ressourcen Hausaufgabenhilfe beanspruchen könnten. Sanders (2006)<br />
weist darauf hin, dass Eltern mit geistiger Behinderung sich sowohl bei Hausaufgaben<br />
wie bei schulischen Veranstaltungen (z. B. Elternabend) überfordert fühlten. Dadurch<br />
73