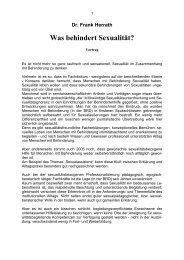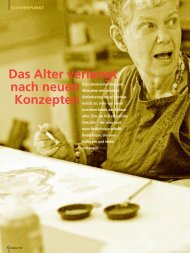Herunterladen PDF - Insieme
Herunterladen PDF - Insieme
Herunterladen PDF - Insieme
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Kinder, wie auch die angepasste Wohnform betreffen. Sozialarbeitende könnten<br />
Schlussteil<br />
aufgrund ihrer Kontakte mit Eltern im Sinne einer interdisziplinären Zusammenarbeit<br />
mitwirken bei der Bedarfsabklärung und der Evaluation von Dienstleistungen.<br />
Mögliche Mögliche Wohnformen<br />
Wohnformen<br />
Ein wichtiges Thema, das auch an der Tagung von Hoyningen-Süess und Stauden-<br />
maier (2004) geäussert wurde, ist die angepasste Wohnform. Eine Teilnehmerin<br />
formulierte: „Wenn Elternschaft, dann dringend gute Wohn- und Lebenssituationen mit<br />
Unterstützung zur Verfügung stellen!“ (S. 48). Dabei kann das Spektrum von der<br />
stationären Betreuung in Wohnheimen, über heilpädagogische Lebensgemeinschaften<br />
und Grossfamilien, ambulante Begleitung bis zu begleiteter innerfamiliärer Betreuung<br />
und/oder Coaching gehen. Zu beachten sind dabei die verschiedenen Vor- und<br />
Nachteile der unterschiedlichen Wohnformen, wie sie Lamesch et. al (2002) in ihrer<br />
Untersuchung ebenfalls erwähnen.<br />
Das Wohnen in der Herkunftsfamilie kann eine kontinuierliche Begleitung in der<br />
Elternrolle gewährleisten. Allerdings vergrössert diese Form auch die gegenseitige<br />
Abhängigkeit und erschwert die Ablösung der Eltern von ihrer behinderten Tochter/<br />
ihrem behinderten Sohn und umgekehrt. Ebenso besteht auch eine hohe Wahr-<br />
scheinlichkeit, dass die Grosseltern die Elternrolle übernehmen und die leiblichen<br />
Eltern aufgrund ihrer geistigen Behinderung ‚entfähigen’.<br />
Die Wohnheime wiederum entsprechen nur teilweise dem heute in der Betreuung<br />
von Menschen mit geistiger Behinderung geforderten Normalisierungsprinzip. Dem<br />
eigenen Tagesrhythmus, der eigenen Gestaltung der Räume, dem Empfang von<br />
Besuchen ohne Kontrolle der Betreuer/innen sind durch die institutionellen Richtlinien<br />
oftmals Grenzen gesetzt. Wenn Eltern mit ihrem Kind/ihren Kindern in Wohnheimen<br />
für Menschen mit geistiger Behinderung leben, müssten zudem Strukturen geschaffen<br />
werden, die es dem Kind/den Kindern ermöglichen, mit Gleichaltrigen aufzuwachsen<br />
und erwachsene Bezugspersonen ohne Einschränkungen zu haben. Gerade beim<br />
letztgenannten Punkt besteht in einer Institution die Gefahr, dass Betreuer/innen die<br />
Elternrolle übernehmen.<br />
Institutionen, die klare agogische Überlegungen in den Vordergrund stellen, die die<br />
Mütter befähigen sollen, ihren Möglichkeiten gemäss zunehmend mehr Verantwortung<br />
in der Elternrolle zu übernehmen, sind die Häuser für Mutter und Kind. Einerseits<br />
schliessen diese Häuser die Anwesenheit der Väter grösstenteils aus, andererseits<br />
wollen sie die Mütter auf das selbstständige Wohnen vorbereiten und sind somit in<br />
der Regel befristete Angebote. Mütter mit einer geistigen Behinderung sind aber<br />
allenfalls auf eine „lebenslange“ Unterstützung bei der Erziehung ihrer Kinder ange-<br />
wiesen. (S. 23f.)<br />
83