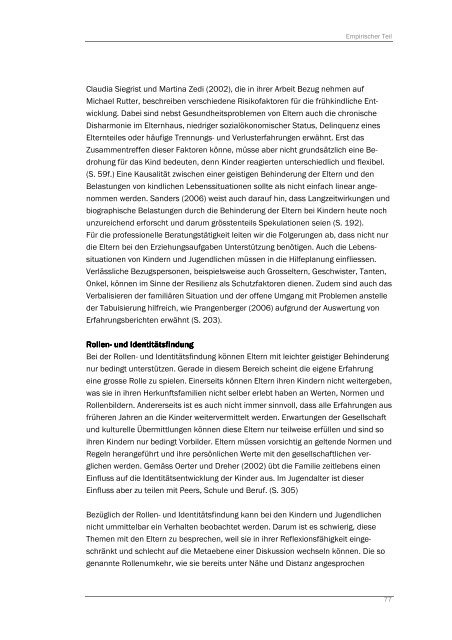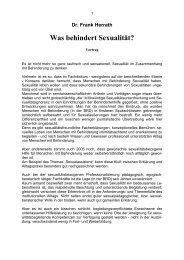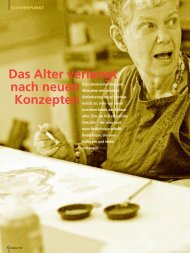Herunterladen PDF - Insieme
Herunterladen PDF - Insieme
Herunterladen PDF - Insieme
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Claudia Siegrist und Martina Zedi (2002), die in ihrer Arbeit Bezug nehmen auf<br />
Empirischer Teil<br />
Michael Rutter, beschreiben verschiedene Risikofaktoren für die frühkindliche Ent-<br />
wicklung. Dabei sind nebst Gesundheitsproblemen von Eltern auch die chronische<br />
Disharmonie im Elternhaus, niedriger sozialökonomischer Status, Delinquenz eines<br />
Elternteiles oder häufige Trennungs- und Verlusterfahrungen erwähnt. Erst das<br />
Zusammentreffen dieser Faktoren könne, müsse aber nicht grundsätzlich eine Be-<br />
drohung für das Kind bedeuten, denn Kinder reagierten unterschiedlich und flexibel.<br />
(S. 59f.) Eine Kausalität zwischen einer geistigen Behinderung der Eltern und den<br />
Belastungen von kindlichen Lebenssituationen sollte als nicht einfach linear ange-<br />
nommen werden. Sanders (2006) weist auch darauf hin, dass Langzeitwirkungen und<br />
biographische Belastungen durch die Behinderung der Eltern bei Kindern heute noch<br />
unzureichend erforscht und darum grösstenteils Spekulationen seien (S. 192).<br />
Für die professionelle Beratungstätigkeit leiten wir die Folgerungen ab, dass nicht nur<br />
die Eltern bei den Erziehungsaufgaben Unterstützung benötigen. Auch die Lebens-<br />
situationen von Kindern und Jugendlichen müssen in die Hilfeplanung einfliessen.<br />
Verlässliche Bezugspersonen, beispielsweise auch Grosseltern, Geschwister, Tanten,<br />
Onkel, können im Sinne der Resilienz als Schutzfaktoren dienen. Zudem sind auch das<br />
Verbalisieren der familiären Situation und der offene Umgang mit Problemen anstelle<br />
der Tabuisierung hilfreich, wie Prangenberger (2006) aufgrund der Auswertung von<br />
Erfahrungsberichten erwähnt (S. 203).<br />
Rollen Rollen- Rollen und und Identitätsfindung<br />
Bei der Rollen- und Identitätsfindung können Eltern mit leichter geistiger Behinderung<br />
nur bedingt unterstützen. Gerade in diesem Bereich scheint die eigene Erfahrung<br />
eine grosse Rolle zu spielen. Einerseits können Eltern ihren Kindern nicht weitergeben,<br />
was sie in ihren Herkunftsfamilien nicht selber erlebt haben an Werten, Normen und<br />
Rollenbildern. Andererseits ist es auch nicht immer sinnvoll, dass alle Erfahrungen aus<br />
früheren Jahren an die Kinder weitervermittelt werden. Erwartungen der Gesellschaft<br />
und kulturelle Übermittlungen können diese Eltern nur teilweise erfüllen und sind so<br />
ihren Kindern nur bedingt Vorbilder. Eltern müssen vorsichtig an geltende Normen und<br />
Regeln herangeführt und ihre persönlichen Werte mit den gesellschaftlichen ver-<br />
glichen werden. Gemäss Oerter und Dreher (2002) übt die Familie zeitlebens einen<br />
Einfluss auf die Identitätsentwicklung der Kinder aus. Im Jugendalter ist dieser<br />
Einfluss aber zu teilen mit Peers, Schule und Beruf. (S. 305)<br />
Bezüglich der Rollen- und Identitätsfindung kann bei den Kindern und Jugendlichen<br />
nicht ummittelbar ein Verhalten beobachtet werden. Darum ist es schwierig, diese<br />
Themen mit den Eltern zu besprechen, weil sie in ihrer Reflexionsfähigkeit einge-<br />
schränkt und schlecht auf die Metaebene einer Diskussion wechseln können. Die so<br />
genannte Rollenumkehr, wie sie bereits unter Nähe und Distanz angesprochen<br />
77