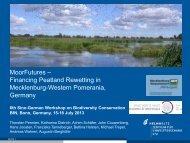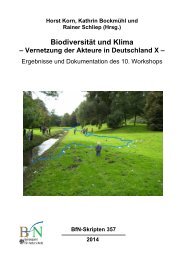Landschaften in Deutschland 2030 Erlittener Wandel – gestalteter ...
Landschaften in Deutschland 2030 Erlittener Wandel – gestalteter ...
Landschaften in Deutschland 2030 Erlittener Wandel – gestalteter ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Landschaften</strong> <strong>in</strong> <strong>Deutschland</strong> <strong>2030</strong>: <strong>Erlittener</strong> <strong>Wandel</strong> <strong>–</strong> <strong>gestalteter</strong> <strong>Wandel</strong><br />
phen‘ menschliches Handeln e<strong>in</strong>geflossen ist, wenn auch <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er kausal letztlich nicht mehr<br />
auflösbaren Form, aber wir können offenbar solche Erkenntnis (noch) nicht <strong>in</strong> die mentalen<br />
Grundlagen unseres Naturverhältnisses aufnehmen.<br />
Über die naturtheoretischen Annahmen, die auch unseren Landschaftsvorstellungen zugrun‐<br />
de liegen, kann ich hier nicht sprechen. Es wäre aber e<strong>in</strong>es gründlichen Nachdenkens wahr‐<br />
haftig wert, woher unsere Kategorien und Kriterien kommen, mit denen wir <strong>–</strong> bewusst oder<br />
unbewusst <strong>–</strong> den ‚Kulturanteil‘ <strong>in</strong> den Prozessen nicht <strong>in</strong>tendierter Landschaftsveränderun‐<br />
gen vom ‚Naturanteil‘ unterscheiden. Gemäß unserer historisch höchst e<strong>in</strong>geschränkten<br />
Denkweise müssen wir an der kategorialen Trennung festhalten, auch wenn sie täglich, <strong>in</strong><br />
tausend Phänomenen des Alltagslebens sich als fiktiv zu erkennen gibt, noch <strong>in</strong> den kle<strong>in</strong>en<br />
Ersche<strong>in</strong>ungen landschaftlichen <strong>Wandel</strong>s. Übrigens wäre die erkenntnistheoretische ‚Alterna‐<br />
tive‘ ke<strong>in</strong>eswegs, das ‚Gegenüber‘ von menschlichem Individuum und begegnender Naturer‐<br />
sche<strong>in</strong>ung aufgehoben sehen zu wollen, nach Art etwa e<strong>in</strong>er mystischen oder pansophischen<br />
Verschmelzung. Aber die Revision jener kategorialen Differenz, bis <strong>in</strong> die Vorstellung vom<br />
‚Naturhaften‘ und ‚Kulturbed<strong>in</strong>gten‘ an anthropogen veränderten <strong>Landschaften</strong>, würde auch<br />
das Problem der unbeabsichtigten Erzeugung solcher <strong>Landschaften</strong> im gesellschaftlichen Pro‐<br />
zess fraglos <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em völlig anderen Licht ersche<strong>in</strong>en lassen <strong>–</strong> übrigens für ‚naturnahe‘ ländli‐<br />
che <strong>Landschaften</strong> ebenso wie für die vorgeblich ‚künstlichen‘ Lebenswelten urbaner Ballungs‐<br />
räume.<br />
Noch e<strong>in</strong>e weitere, kurze Abschweifung, bevor ich zur Verfertigung nicht gewollter Land‐<br />
schaften <strong>in</strong> unseren Zeitläuften zurückkomme. Denn der E<strong>in</strong>wurf ist ja zu erwarten, Kultur‐<br />
landschaften seien im Verlauf der geschichtlichen Entwicklung, spätestens seit der so genann‐<br />
ten neolithischen Revolution, immer unbeabsichtigtes Ergebnis menschlicher Tätigkeiten<br />
gewesen. Weder die Entwaldung der Mittelmeerregion noch die Gestaltung der Alpen mit<br />
den Almen und Bannwäldern noch die ‚<strong>in</strong>dianischen Anteile‘ bei der Formung der Pla<strong>in</strong>s <strong>in</strong><br />
Nordamerika seien je <strong>–</strong> als Momente der Landschaftsformung <strong>–</strong> zweckrational angezielt ge‐<br />
wesen. Das dürfte, cum grano salis, zutreffen. Nur haben wir es beim Stadium unserer zeitge‐<br />
nössischen, nicht direkt <strong>in</strong>tendierten Landschaftsveränderungen mit jenem ‚Umschlag von<br />
Quantität <strong>in</strong> Qualität‘ zu tun, der gleichermaßen für den Klimawandel oder den <strong>in</strong>dustriellen<br />
Ressourcenverbrauch gilt: Wo die nicht bedachten Rückkoppelungen menschlicher Tätigkeit<br />
<strong>in</strong> die natürlichen Vorgänge e<strong>in</strong> solches Ausmaß erreicht haben wie <strong>in</strong> der Gegenwart, erle‐<br />
digt sich der H<strong>in</strong>weis „Das war doch im Grunde schon immer so“. Zum ersten Mal <strong>in</strong> der<br />
Evolutionsgeschichte der Gattung Mensch haben wir es mit dem Tatbestand zu tun, dass die<br />
nicht beabsichtigten Folgen menschlicher ‚Arbeit an der Natur‘ global die Lebensbed<strong>in</strong>gun‐<br />
gen zukünftiger Generationen massiv bee<strong>in</strong>trächtigen, womöglich langfristig sogar den Fort‐<br />
bestand zum<strong>in</strong>dest der Gattung selbst gefährden können. 1 Dass unter anderem mit den land‐<br />
schaftlichen Veränderungen die ‚natürlichen Grundlagen‘ unserer Lebensform <strong>–</strong> von den<br />
Existenzmöglichkeiten anderer Lebewesen zu schweigen <strong>–</strong> ungewollt auf Spiel gesetzt wer‐<br />
den, ist eben ke<strong>in</strong> lokales Phänomen mehr wie beim berüchtigten Zivilisationskollaps auf der<br />
Oster<strong>in</strong>sel 2 und auch ke<strong>in</strong> regionales wie offenkundig beim Zusammenbruch mittelamerika‐<br />
nischer Hochkulturen. Deshalb verfängt der H<strong>in</strong>weis nicht, immer schon hätten Menschen,<br />
ohne es bewusst darauf angelegt zu haben, ihre natürlichen Umgebungen mehr oder weniger<br />
tief greifend zu Kulturlandschaften verändert. Er würde höchstens dann noch gelten können,<br />
wenn wir mit vollem Wissen <strong>in</strong> Kauf nehmen wollen, dass es <strong>in</strong> tatsächlich absehbarer Zeit<br />
1 Dazu schon Rolf Peter Sieferle: Die Krise der menschlichen Natur. Zur Geschichte e<strong>in</strong>es Konzepts.<br />
Frankfurt/M: Suhrkamp 1989, S. 10ff.<br />
2 Vgl. Jared Diamond: Kollaps. Frankfurt/M.: Suhrkamp 2005.<br />
8