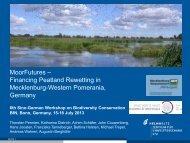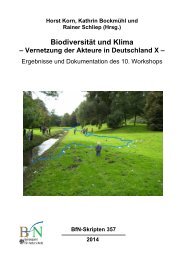Landschaften in Deutschland 2030 Erlittener Wandel – gestalteter ...
Landschaften in Deutschland 2030 Erlittener Wandel – gestalteter ...
Landschaften in Deutschland 2030 Erlittener Wandel – gestalteter ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Landschaften</strong> <strong>in</strong> <strong>Deutschland</strong> <strong>2030</strong>: <strong>Erlittener</strong> <strong>Wandel</strong> <strong>–</strong> <strong>gestalteter</strong> <strong>Wandel</strong><br />
gen, mit denen sich E<strong>in</strong>stellungen, Gewohnheiten, Handlungsstrategien verb<strong>in</strong>den, üben ei‐<br />
nen enormen ‚Zwang‘ aus, wir können uns ihnen nur schwer entziehen. Und solche gesell‐<br />
schaftlich auf e<strong>in</strong>e schwer erklärbare Weise erzeugten Zwänge formen dann jenen ‚sozialen<br />
Leib‘, zu dem ‚wir‘ gehören. Auch wenn wir die Rede vom sozialen Leib als e<strong>in</strong>e Metapher<br />
verstehen, kann man sich damit helfen, um <strong>–</strong> unter anderem <strong>–</strong> davon sprechen zu können,<br />
dass ‚wir‘ offenbar e<strong>in</strong> Empf<strong>in</strong>den dafür entwickelt haben, dass ‚wir‘ <strong>in</strong> unserer Zivilisation<br />
Realitäten <strong>–</strong> wie beispielsweise <strong>Landschaften</strong> <strong>–</strong> erzeugen, ‚die wir eigentlich gar nicht wollen‘.<br />
Hampe spricht von e<strong>in</strong>er „symbolischen Bereitschaft“, die Wahrnehmung zu akzeptieren,<br />
„dass die Lebensform sich ändern muss.“ 22<br />
Ich bleibe also zum Schluss doch bei me<strong>in</strong>er Titel‐Behauptung ‚Wir machen <strong>Landschaften</strong>, die<br />
wir eigentlich nicht wollen‘, auch wenn ich um die geschichtstheoretischen, sozialtheoreti‐<br />
schen, naturtheoretischen Schwierigkeiten mit e<strong>in</strong>er solchen Redeweise weiß. Denn mir<br />
sche<strong>in</strong>t die „symbolische Bereitschaft“ <strong>in</strong> unserem Kulturkreis, das ‚Unbehagen‘ mit den von<br />
uns erzeugten Realitäten nicht e<strong>in</strong>fach als Preis der zivilisatorischen Errungenschaften weiter<br />
h<strong>in</strong>zunehmen, unverkennbar. Daraus kann auch der Anspruch folgen, den E<strong>in</strong>zelne an sich<br />
stellen, sich den ‚Denkzwängen‘ 23 der gewohnten Lebensweise zu entziehen. Zu solchen<br />
Zwängen gehören auch <strong>–</strong> ich sage das durchaus selbstkritisch <strong>–</strong> die Regeln und Rout<strong>in</strong>en des<br />
wissenschaftlichen Vorgehens, selbstverständlich auch die der planerischen Entwürfe und<br />
Handlungsmöglichkeiten. Es käme dann darauf an, so anders beispielsweise vom Natürlichen<br />
und unserem Verhältnis zum Naturgegebenen zu ‚erzählen‘, dass e<strong>in</strong>e Veränderung der Le‐<br />
bensform möglich ersche<strong>in</strong>t. Dann erschienen uns auch andere <strong>Landschaften</strong> möglich als die‐<br />
jenigen, die wir aus der Extrapolation der gegenwärtigen Verhältnisse <strong>in</strong> die Zukunft me<strong>in</strong>en<br />
vor uns sehen zu müssen. Wo und wie solche ‚anderen Erzählungen‘ beg<strong>in</strong>nen können? Viel‐<br />
leicht tatsächlich bei unserem Leib als der Natur, „die wir s<strong>in</strong>d“ 24 , dem Leib als untrennbarer<br />
Verschränkung von sozialem, kulturellem und naturhaften Se<strong>in</strong>, den wir dann nicht mehr<br />
nur, wie wir es gelernt haben, als das ‚Naturd<strong>in</strong>g Körper‘ begreifen können. Landschaft be‐<br />
zeichnet e<strong>in</strong> bestimmtes Verhältnis unseres Leibes zu se<strong>in</strong>en ke<strong>in</strong>eswegs e<strong>in</strong>fach ‚gegenständ‐<br />
lichen‘ Umgebungen <strong>–</strong> aber damit s<strong>in</strong>d andere Themen eröffnet als das hier erörterte.<br />
Nachsatz: Davon zu reden, dass wir ‚<strong>Landschaften</strong> machen, die wir eigentlich gar nicht wol‐<br />
len‘, erfordert <strong>–</strong> argumentationslogisch betrachtet <strong>–</strong> eigentlich, auch über diejenigen Land‐<br />
schaften etwas auszusagen, die ‚wir machen wollen‘. Dem nachzukommen, müsste bedeuten,<br />
die Mentalitätsgeschichte leitender Landschaftsvorstellungen zu betrachten, von Arkadien bis<br />
zur ‚Techno‐Landschaft‘ urbaner Ballungsräume oder zur modernen Wiederkehr e<strong>in</strong>er ‚halb‐<br />
offenen Weidelandschaft‘. Diese Leerstelle der vorstehenden Erwägungen bleibt vorläufig<br />
bestehen.<br />
22 Ebd., S. 279.<br />
23 Der Begriff stammt von Ludwik Fleck: Entstehung und Entwicklung e<strong>in</strong>er wissenschaftlichen<br />
Tatsache. E<strong>in</strong>führung <strong>in</strong> die Lehre vom Denkstil und Denkkollektiv. Frankfurt/M. Suhrkamp 1980<br />
[zuerst 1935].<br />
24 Gernot Böhme: Leib: Die Natur, die wir selbst s<strong>in</strong>d. In: ders., Natürlich Natur. Über Natur im<br />
Zeitalter ihrer technischen Reproduzierbarkeit. Frankfurt/M.: Suhrkamp 1992, S. 77<strong>–</strong>93.<br />
16