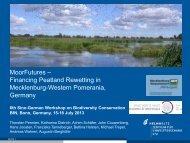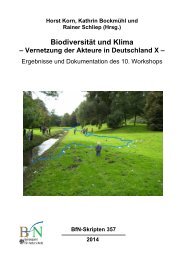Landschaften in Deutschland 2030 Erlittener Wandel – gestalteter ...
Landschaften in Deutschland 2030 Erlittener Wandel – gestalteter ...
Landschaften in Deutschland 2030 Erlittener Wandel – gestalteter ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Landschaften</strong> <strong>in</strong> <strong>Deutschland</strong> <strong>2030</strong>: <strong>Erlittener</strong> <strong>Wandel</strong> <strong>–</strong> <strong>gestalteter</strong> <strong>Wandel</strong><br />
tiven auf „Landschaft“: Die „Kulturlandschaft“ gilt als e<strong>in</strong> bedeutendes öffentliches Gut, das<br />
als wertgeschätztes Kuppelprodukt der agrarischen Produktion anfällt. Implizit stehen Kul‐<br />
turlandschaftsverständnisse des Heimat‐ und Naturschutzes im Vordergrund. „Kulturland‐<br />
schaft“ ist e<strong>in</strong> strategischer, positiv besetzter Term<strong>in</strong>us, der verwendet wird, um die Leistun‐<br />
gen der Landwirtschaft für die Allgeme<strong>in</strong>heit hervorzuheben, wobei Gebiete <strong>in</strong>tensiver<br />
Produktion und Spuren traditioneller Bewirtschaftung gleichermaßen geme<strong>in</strong>t s<strong>in</strong>d. In der<br />
Agrarpolitik wird die „Kulturlandschaft“ häufig dann explizit thematisiert, wenn <strong>in</strong> postpro‐<br />
duktivistischen Debatten auf Kritik an der landwirtschaftlichen Überproduktion und an den<br />
schädlichen Umweltwirkungen der Intensivlandwirtschaft reagiert werden soll, und wenn<br />
die Honorierung landwirtschaftlicher Tätigkeiten begründet wird. Er dient <strong>in</strong> pragmatischer<br />
Weise für die Begründung von Förder‐ und Politikansätzen, z. B. für Agrarumweltmaßnah‐<br />
men, für die Abgrenzung regionaler Handlungsräume der <strong>in</strong>tegrierten ländlichen Entwick‐<br />
lung und als Grundlage regionaler Marken.<br />
Die ländliche Entwicklungspolitik ist <strong>in</strong> ihrer heutigen Prägung e<strong>in</strong> Ergebnis agrarpolitischer<br />
Reformen der vergangenen zwei Jahrzehnte, <strong>in</strong> deren Verlauf sich auch Wertorientierungen<br />
änderten. Die Agrarpolitik <strong>in</strong> <strong>Deutschland</strong> und der EU zielte noch bis weit <strong>in</strong> die 1990er Jahre<br />
h<strong>in</strong>e<strong>in</strong> primär auf die Förderung e<strong>in</strong>er hochproduktiven und ‐effizienten landwirtschaftlichen<br />
Produktion von Rohstoffen und Nahrungsmitteln <strong>in</strong> optimierten Betriebse<strong>in</strong>heiten <strong>–</strong> und da‐<br />
mit auf unternehmerische und betriebswirtschaftliche Wertkategorien wie Effizienz, Produk‐<br />
tivitätssteigerung, e<strong>in</strong>zelbetriebliches Wachstum, Profitabilität und die Möglichkeit, unter‐<br />
nehmerische Gew<strong>in</strong>ne zu erzielen (vgl. SHERIDAN 2006).<br />
Da aber im Zuge von Überschussproduktion, steigenden Kosten, ökologischen Krisen und<br />
Lebensmittelskandalen die Agrarpolitik mittlerweile als „gesellschaftliches Problemfeld“<br />
(KRÖGER 2006: 151) gilt, wird zunehmend e<strong>in</strong> Kanon weiterer Werte betont, die von multi‐<br />
funktionalen Leistungen agrarischer Produktion ausgehen. Anknüpfend an volkswirtschaftli‐<br />
che Werte wie der Stärkung von Standortfaktoren für ökonomisches Wachstum im ländlichen<br />
Raum werden auf Ebene von EU und OECD „non‐commodity outputs“, also nicht‐<br />
warenbezogene Güter wie ökologische, soziale und kulturelle Leistungen der Landwirtschaft<br />
hervorgehoben (vgl. WIGGERING & HELMING 2008: 206). Diese umfassen den Schutz der biolo‐<br />
gischen Vielfalt, von Wasser, Klima und sonstigen Naturressourcen sowie die Sicherung der<br />
Attraktivität von <strong>Landschaften</strong>, des kulturellen Erbes und von Lebensqualität. In der Regel<br />
geht es dabei aber nicht um diese Werte „an sich“, sondern um deren Nutzen für e<strong>in</strong>e öko‐<br />
nomische Stabilisierung ländlicher Räume.<br />
2.4 Tourismuspolitik<br />
Aus tourismuspolitischer Sicht ist die Landschaft e<strong>in</strong> grundlegender Wirtschaftsfaktor. Tou‐<br />
rismusentwicklung ist angewiesen auf „die Schaffung unverwechselbarer, glaubwürdiger<br />
und standortbezogener Orte, die auf der vorhandenen Kulturlandschaft aufbauen. Der Ver‐<br />
marktungsansatz zielt auf e<strong>in</strong>e USP [Unique Sell<strong>in</strong>g Proposition = Alle<strong>in</strong>stellungsmerkmal im<br />
Wettbewerbsumfeld], <strong>in</strong> der die E<strong>in</strong>zigartigkeit e<strong>in</strong>es Raumes durch Nutzung und Weiter‐<br />
entwicklung vorhandener Kulturgüter und natürlicher Ressourcen zum Ausdruck kommt“<br />
(ALBERTIN 2006: 52). Schon seit den Anfängen des modernen Tourismus im 19. Jahrhundert<br />
bewegt sich der Tourismus <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Spannungsfeld zwischen romantischen Sehnsüchten<br />
nach unversehrter Natur e<strong>in</strong>erseits und touristischen Nutzungsformen, „die Natur zur Ware<br />
und zum Wirtschaftssektor degradieren, so dass der Tourismus selbst zum Belastungsfaktor<br />
für Natur und Landschaft erwachsen sollte“ (SCHMOLL 2004: 131).<br />
38