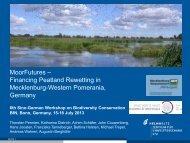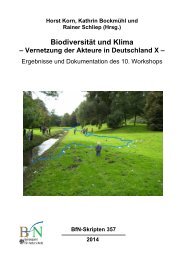Landschaften in Deutschland 2030 Erlittener Wandel – gestalteter ...
Landschaften in Deutschland 2030 Erlittener Wandel – gestalteter ...
Landschaften in Deutschland 2030 Erlittener Wandel – gestalteter ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Dirk Wascher SUSMETRO <strong>–</strong> e<strong>in</strong> Steuerungs<strong>in</strong>strumentarium<br />
In den neuen Gesetzes<strong>in</strong>itiativen der Bundesregierung, wie z. B. die Rohstoffstrategie, s<strong>in</strong>d<br />
o. g. Nachhaltigkeitspr<strong>in</strong>zipien schon deutlich verankert. Auch bei der dem deutschen Ansatz<br />
folgenden Europäischen Ressourceneffizienzstrategie (Europäische Kommission 2005) nimmt<br />
der Gesichtspunkt der „effizienten Ressourcennutzung“ e<strong>in</strong>e zentrale Stellung e<strong>in</strong>. Demnach<br />
bedeutet nachhaltige Rohstoffgew<strong>in</strong>nung nicht nur, „Rohstoffe umweltverträglich zu gew<strong>in</strong>‐<br />
nen, sondern auch bestehende Rohstoffpotenziale bestmöglich zu nutzen.“ Und weiter heißt<br />
es: „Die Sicherung der Rohstoffversorgung der Wirtschaft und die Verbesserung der Wirt‐<br />
schaftskraft der Länder kann <strong>in</strong> Übere<strong>in</strong>stimmung mit deren regionalen umwelt‐und sozial‐<br />
politischen Zielsetzungen erreicht werden. Landschaftsgestaltung, Naherholung, Umweltbio‐<br />
tope und Rohstoffabbau, verbunden mit der Schaffung zusätzlicher Arbeitsplätze, s<strong>in</strong>d nicht<br />
zwangsläufig konträre Zielsetzungen. Sie lassen sich vielmehr im eigentlichen dreiteiligen<br />
S<strong>in</strong>ne des Nachhaltigkeitsgedankens von Ökonomie, Ökologie und Sozialem zu e<strong>in</strong>em In‐<br />
teressensausgleich zusammenführen.“ (BMWI 2010) Es gibt ke<strong>in</strong>en Grund, warum diese der<br />
Rohstoffsicherung unterliegenden Pr<strong>in</strong>zipien nicht schon bald auch auf die zunehmend be‐<br />
grenzte Ressource „landwirtschaftliche Nutzfläche“ oder auch auf das gesellschaftliche Gut<br />
„Kulturlandschaft“ angewendet werden sollte. E<strong>in</strong>e nähere Betrachtung der gegenwärtigen<br />
„Flächenpolitik“ im Bereich der Nahrungsmittelproduktion lässt jedenfalls den Schluss zu,<br />
dass es e<strong>in</strong> ausgesprochenes Nachhaltigkeitsproblem bezüglich der ökologischen Fußabdrük‐<br />
ke urbaner Bevölkerung aufgrund extrem langer Transportwege, technischer klima‐ und<br />
umweltschädigender Produktionsabläufe, sowie exzessiver Mengen von Nahrungsmittelab‐<br />
fällen gibt (WEIDEMA et al. 2008; KASTNER et al. 2011; VUUREN AND SMEETS 2000; KAMPHUS<br />
et al. 2010). Auf diese Problematik soll im dritten Abschnitt noch detaillierter e<strong>in</strong>gegangen<br />
werden. Die landschafts‐ und naturschutzpolitische Fragen, die sich aus diesen Problemen<br />
ableiten, s<strong>in</strong>d so zu umreißen:<br />
� Wie lange wird man die Flächennutzung metropolitaner Großräume noch s<strong>in</strong>gulären,<br />
export‐orientierten Vermarktungs<strong>in</strong>teressen überlassen, während städtische Ballungs‐<br />
räume immer abhängiger von wirtschaftspolitischen Großwetterlagen und Versorgungs‐<br />
kapazitäten weit entfernter Produktionsstandorte werden?<br />
� Warum sollte stadtnahen Gebieten nicht e<strong>in</strong>e viel größere Bedeutung <strong>in</strong> ihrer Versor‐<br />
gungsfunktion und ‐verantwortung gegenüber urbanen Zentren e<strong>in</strong>geräumt werden?<br />
� Welche landwirtschaftlichen Betriebsmodelle s<strong>in</strong>d dafür notwendig und was s<strong>in</strong>d die<br />
Konsequenzen für die jetzige Natur‐ und Erholungslandschaft <strong>in</strong> diesen Räumen?<br />
H<strong>in</strong>sichtlich der hierfür notwendigen Steuerungs<strong>in</strong>strumente bleibt nur die Feststellung, dass<br />
die dem urbanen Nahrungsmittelkonsum geschuldeten Flächennutzungskonflikte bislang nur<br />
<strong>in</strong> Ansätzen thematisiert worden s<strong>in</strong>d, geschweige denn, planerischen bzw. unternehmeri‐<br />
schen Lösungen zugeführt werden.<br />
1.2 Nahrungsplanung: e<strong>in</strong>e besondere<br />
Herausforderungen für die Zukunft?<br />
Obwohl die holländische Vorreiterstellung <strong>in</strong> der Entwicklung und Anwendung planerischer<br />
Instrumente weith<strong>in</strong> bekannt se<strong>in</strong> dürfte, sollte an dieser Stelle gleich klargestellt werden, das<br />
der Begriff der „Nahrungsplanung“ (Foodplann<strong>in</strong>g) selbst <strong>in</strong> den Niederlanden noch als No‐<br />
vum gilt (WISKERKE 2009; VILIOEN 2005; SONNINO 2009; APA 2007). In den Niederlanden, wie<br />
auch <strong>in</strong> <strong>Deutschland</strong> und anderen europäischen Staaten, gibt es zwar landwirtschaftliche<br />
Strukturplanung e<strong>in</strong>schließlich wasserbaulicher u. verkehrstechnischer Maßnahmen, aber<br />
noch ke<strong>in</strong>e Nahrungsplanung im eigentlichen S<strong>in</strong>n des Wortes. Als Nahrungsplanung ist<br />
nämlich e<strong>in</strong>e räumlich‐logistische Vorhalteplanung zu verstehen, die der mittel‐ und langfri‐<br />
59