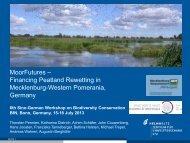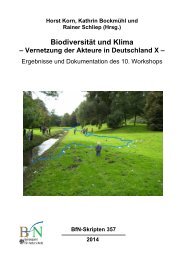Landschaften in Deutschland 2030 Erlittener Wandel – gestalteter ...
Landschaften in Deutschland 2030 Erlittener Wandel – gestalteter ...
Landschaften in Deutschland 2030 Erlittener Wandel – gestalteter ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Ludger Gail<strong>in</strong>g Landschaft im Spannungsfeld sektoraler Politikfelder<br />
<strong>Landschaften</strong> s<strong>in</strong>d e<strong>in</strong>e ökonomische Basis des Tourismus und als solche als emotional positiv<br />
aufgeladene Produkte zu vermarkten sowie auch <strong>in</strong> physisch‐materieller H<strong>in</strong>sicht zu er‐<br />
schließen. Dabei ist Tourismusentwicklung auf Zuschreibungen spezifischer regionaler Ei‐<br />
genarten im S<strong>in</strong>ne e<strong>in</strong>es geme<strong>in</strong>samen Images angewiesen, die sie <strong>in</strong> ihren Market<strong>in</strong>gbemü‐<br />
hungen aufgreift und (re)strukturiert. <strong>Landschaften</strong> können zu Dest<strong>in</strong>ationen entwickelt<br />
werden, die als virtuelle Unternehmungen und Wettbewerbse<strong>in</strong>heiten fungieren (vgl. BECKER<br />
2007).<br />
Die entscheidende Wertorientierung der Tourismuspolitik ist die Steigerung der regionalen<br />
Wohlfahrt im S<strong>in</strong>ne e<strong>in</strong>er Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit und der Bedeutung der Bran‐<br />
che (vgl. FUCHS 2006). Insbesondere <strong>in</strong> strukturschwachen Regionen gilt Tourismus <strong>–</strong> oft aus<br />
Mangel an Alternativen <strong>–</strong> als „Hoffnungsträger“ oder „Entwicklungsfaktor“ mit regionalwirt‐<br />
schaftlichen Effekten. In Grundlagenwerken zur Tourismusentwicklung (vgl. z. B. SCHERHAG<br />
2003) dom<strong>in</strong>ieren betriebswirtschaftliche Perspektiven und Werte: Landschaft, verstanden als<br />
regionale Kultur, Topographie, Images oder Mythen werden als e<strong>in</strong> dem Tourismusmarkt<br />
angemessenes touristisches Bündelprodukt verstanden, wobei ökonomische Verwertungs<strong>in</strong>‐<br />
teressen im Vordergrund stehen. Grundsätzlich s<strong>in</strong>d hier sekundär auch ökologische oder<br />
kulturelle Werte relevant, z. B. als Basis für e<strong>in</strong>en dauerhaft erfolgreichen Natur‐ oder Kultur‐<br />
tourismus.<br />
2.5 Raumplanung und -entwicklung<br />
Die raumplanerische Realitätskonstruktion <strong>in</strong> Bezug auf „Landschaft“ ist nicht e<strong>in</strong>heitlich. Im<br />
Fachdiskurs wird „Kulturlandschaftsgestaltung“ teilweise synonym zu „Regionalplanung“<br />
verwendet. „Kulturlandschaft“ steht dann für alle physischen Aspekte von „Raum“, die mit‐<br />
tels formeller Plan<strong>in</strong>strumente bee<strong>in</strong>flusst werden (vgl. PRIEBS 2001). Mit „Kulturlandschaft“<br />
kann aber auch die „historische“ oder „gewachsene“ Kulturlandschaft geme<strong>in</strong>t se<strong>in</strong>. Sie ent‐<br />
spricht dann e<strong>in</strong>em Schutzgut und e<strong>in</strong>em kulturhistorischen Belang, der <strong>in</strong> Abwägungen zu<br />
berücksichtigen ist. „Kulturlandschaftsgestaltung“ gilt zudem zunehmend als Synonym für<br />
e<strong>in</strong>e aktive qualitative Regionalentwicklung zum Beispiel von Regionalparks. Dieses letztge‐<br />
nannte Begriffsverständnis ist auch <strong>in</strong> den aktuell gültigen Leitbildern und Handlungsstrate‐<br />
gien der Raumentwicklung <strong>in</strong> <strong>Deutschland</strong> (vgl. BMVBS 2006) dom<strong>in</strong>ant. Demgegenüber ist<br />
<strong>in</strong> der Regel dann explizit von „Landschaft“ die Rede, wenn fachplanerische Inhalte des Na‐<br />
turschutzes <strong>in</strong> die Raumordnung übernommen werden; hier ist dann eher e<strong>in</strong> landschaftsöko‐<br />
logisches Verständnis relevant.<br />
In der Konkurrenz dieser unterschiedlichen Landschafts‐ und Kulturlandschaftsverständnisse<br />
zeigen sich auch konkurrierende Planungsverständnisse: In idealtypischer Kontrastierung<br />
(vgl. RITTER 1998: 11ff) wird entweder klassisch im S<strong>in</strong>ne e<strong>in</strong>es naturwissenschaftlich‐<br />
technischen Weltbildes mit „überlegener Rationalität“ e<strong>in</strong>e bewusste (Kultur)landschafts‐<br />
gestaltung propagiert, was von der Durchsetzungsfähigkeit formeller räumlicher Planleistun‐<br />
gen ausgeht, oder Planung wird als Prozess verstanden, der im Wesentlichen auf Information,<br />
Überzeugung, Akzeptanz und Kooperation angewiesen ist. (Kultur)landschaftsgestaltung<br />
wäre demnach weniger e<strong>in</strong>e formelle Steuerungs‐ als vielmehr e<strong>in</strong>e gesellschaftliche Dialog‐,<br />
Management‐ und Moderationsaufgabe.<br />
E<strong>in</strong> wesentliches Handlungspr<strong>in</strong>zip der Raumplanung ist angesichts der Vielfalt sozialer, kul‐<br />
tureller, ökonomischer und ökologischer Raumansprüche und ‐funktionen die Abwägung.<br />
Damit verfügt die „überfachliche“ Raumplanung selbst über e<strong>in</strong>en diffusen Wertekanon.<br />
Wichtige Wertorientierungen bezogen auf <strong>Landschaften</strong> s<strong>in</strong>d der Erhalt historisch geprägter,<br />
gewachsener Kulturlandschaften, die Entwicklung von Kulturlandschaften als wichtige Fak‐<br />
39