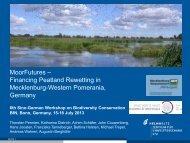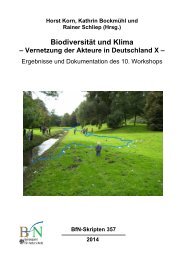Landschaften in Deutschland 2030 Erlittener Wandel – gestalteter ...
Landschaften in Deutschland 2030 Erlittener Wandel – gestalteter ...
Landschaften in Deutschland 2030 Erlittener Wandel – gestalteter ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Ludger Gail<strong>in</strong>g Landschaft im Spannungsfeld sektoraler Politikfelder<br />
sierung stabilisiert. E<strong>in</strong> weiterer Aspekt der Ontologisierung ist die Rolle von Land‐<br />
schaftsbegriffen, die <strong>in</strong> der Regel unh<strong>in</strong>terfragt verwendet werden.<br />
3. der Ebene von Handlungsräumen: In e<strong>in</strong>er kurz‐ und mittelfristigen Zeitperspektive<br />
können diese Ontologisierungen als Handlungsräume „wirksam“ se<strong>in</strong>, die damit Be‐<br />
standteil gesellschaftlicher, vor allem politischer Wirklichkeit werden. Unter landschaftli‐<br />
chen Handlungsräumen können solche ontologisierten <strong>Landschaften</strong> verstanden werden,<br />
<strong>in</strong> denen es gelungen ist, Steuerungsansätze zu entwickeln, die nach <strong>in</strong>nen Handlungsfä‐<br />
higkeit gewährleisten und nach außen die Artikulation regionaler Interessen ermöglichen<br />
(vgl. FÜRST et al. 2008: 94). Beispiele für Handlungsräume <strong>in</strong> diesem S<strong>in</strong>ne s<strong>in</strong>d Groß‐<br />
schutzgebiete wie Naturparke oder Biosphärenreservate, UNESCO‐Welterbeland‐<br />
schaften, Regionalparks, Räume e<strong>in</strong>er <strong>in</strong>tegrierten ländlichen Regionalentwicklung oder<br />
Tourismusregionen. Häufig s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Region mehrere solcher landschaftspolitischer<br />
Handlungsräume zu f<strong>in</strong>den.<br />
Wenn man akzeptiert, dass die Konstruktion von Landschaft e<strong>in</strong> komplexer gesellschaftlicher<br />
(und ke<strong>in</strong>esfalls eben ausschließlich physisch‐materieller) Prozess ist, so erfordert e<strong>in</strong> Nach‐<br />
denken über Landschaftswandel und se<strong>in</strong>e politisch‐planerische Gestaltung e<strong>in</strong>e Ause<strong>in</strong>an‐<br />
dersetzung mit diesen drei Ebenen des sozialen Konstruktionsprozesses von <strong>Landschaften</strong>. So<br />
bed<strong>in</strong>gt e<strong>in</strong>e Befassung mit dem physisch‐materiellen Landschaftswandel e<strong>in</strong>e Klärung der<br />
vielfältigen Triebkräfte, die ihn bewirken: Beispiele hierfür s<strong>in</strong>d der Klimawandel oder der<br />
<strong>Wandel</strong> von Gesetzen und Förderprogrammen, die direkten E<strong>in</strong>fluss auf die Landnutzung<br />
nehmen. In besonders machtvoller Weise wirken beispielsweise die Energie‐ und Landwirt‐<br />
schaftspolitik.<br />
Im Folgenden sollen aber demgegenüber eher Ebenen der landschaftlichen Konstruktion e<strong>in</strong>e<br />
Rolle spielen, die nicht direkt auf die Landnutzung Bezug nehmen. Da Landschaft stets im<br />
Spannungsfeld e<strong>in</strong>er Vielfalt von sektoralen Politikfeldern mit ihren jeweils spezifischen Insti‐<br />
tutionen, Steuerungsformen und Ontologisierungen von Landschaft entwickelt wird, soll e<strong>in</strong><br />
Fokus auf die Unterschiede zwischen landschaftsrelevanten Politiksektoren gelegt werden.<br />
Hierzu wurden ausgewählte sektorale Politikfelder mit besonderer Relevanz für die Konstitu‐<br />
ierung landschaftlicher Handlungsräume untersucht:<br />
� Naturschutz,<br />
� Denkmalpflege,<br />
� Ländliche Entwicklungspolitik (als Teil der Agrarpolitik),<br />
� Tourismuspolitik sowie<br />
� Raumplanung und ‐entwicklung.<br />
Die Forschungsergebnisse wurden im Rahmen des von der Deutschen Forschungsgeme<strong>in</strong>‐<br />
schaft (DFG) geförderten Projektes „KULAKon <strong>–</strong> Institutionen der Kulturlandschaft“ des<br />
Leibniz‐Instituts für Regionalentwicklung und Strukturplanung (IRS) sowie des Dissertati‐<br />
onsvorhabens des Autors zur Thematik der Kulturlandschaftspolitik erarbeitet. Sie basieren<br />
methodisch auf Dokumenten‐ und Literaturanalysen sowie auf Experten<strong>in</strong>terviews.<br />
Es soll zunächst geklärt werden, welche unterschiedlichen Perspektiven auf bzw. Verständ‐<br />
nisse von „Landschaft“ <strong>in</strong> den untersuchten Politikfeldern vorherrschend und welche grund‐<br />
legenden Werte bei der Befassung mit <strong>Landschaften</strong> von Relevanz s<strong>in</strong>d (Kapitel 2). Anschlie‐<br />
ßend steht die Rolle der je nach sektoralem Politikfeld unterschiedlichen Handlungs‐ und<br />
Steuerungsmodi (Kapitel 3) im Fokus.<br />
35