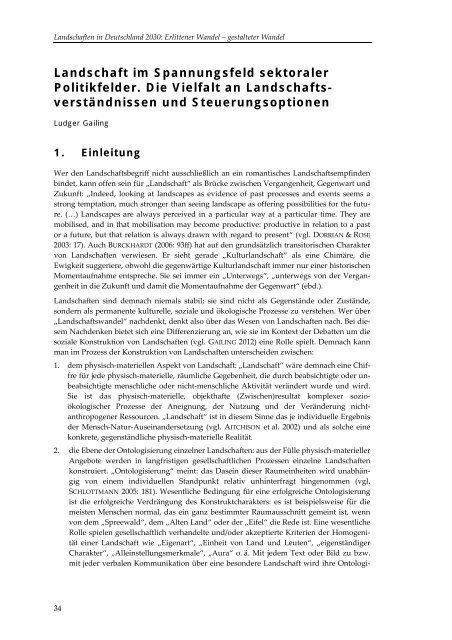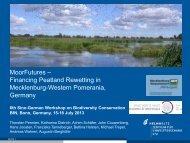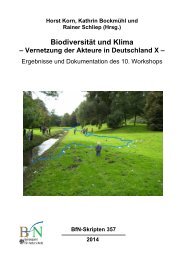Landschaften in Deutschland 2030 Erlittener Wandel – gestalteter ...
Landschaften in Deutschland 2030 Erlittener Wandel – gestalteter ...
Landschaften in Deutschland 2030 Erlittener Wandel – gestalteter ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Landschaften</strong> <strong>in</strong> <strong>Deutschland</strong> <strong>2030</strong>: <strong>Erlittener</strong> <strong>Wandel</strong> <strong>–</strong> <strong>gestalteter</strong> <strong>Wandel</strong><br />
Landschaft im Spannungsfeld sektoraler<br />
Politikfelder. Die Vielfalt an Landschaftsverständnissen<br />
und Steuerungsoptionen<br />
Ludger Gail<strong>in</strong>g<br />
1. E<strong>in</strong>leitung<br />
Wer den Landschaftsbegriff nicht ausschließlich an e<strong>in</strong> romantisches Landschaftsempf<strong>in</strong>den<br />
b<strong>in</strong>det, kann offen se<strong>in</strong> für „Landschaft“ als Brücke zwischen Vergangenheit, Gegenwart und<br />
Zukunft: „Indeed, look<strong>in</strong>g at landscapes as evidence of past processes and events seems a<br />
strong temptation, much stronger than see<strong>in</strong>g landscape as offer<strong>in</strong>g possibilities for the futu‐<br />
re. (…) Landscapes are always perceived <strong>in</strong> a particular way at a particular time. They are<br />
mobilised, and <strong>in</strong> that mobilisation may become productive: productive <strong>in</strong> relation to a past<br />
or a future, but that relation is always drawn with regard to present“ (vgl. DORRIAN & ROSE<br />
2003: 17). Auch BURCKHARDT (2006: 93ff) hat auf den grundsätzlich transitorischen Charakter<br />
von <strong>Landschaften</strong> verwiesen. Er sieht gerade „Kulturlandschaft“ als e<strong>in</strong>e Chimäre, die<br />
Ewigkeit suggeriere, obwohl die gegenwärtige Kulturlandschaft immer nur e<strong>in</strong>er historischen<br />
Momentaufnahme entspreche. Sie sei immer e<strong>in</strong> „Unterwegs“, „unterwegs von der Vergan‐<br />
genheit <strong>in</strong> die Zukunft und damit die Momentaufnahme der Gegenwart“ (ebd.).<br />
<strong>Landschaften</strong> s<strong>in</strong>d demnach niemals stabil; sie s<strong>in</strong>d nicht als Gegenstände oder Zustände,<br />
sondern als permanente kulturelle, soziale und ökologische Prozesse zu verstehen. Wer über<br />
„Landschaftswandel“ nachdenkt, denkt also über das Wesen von <strong>Landschaften</strong> nach. Bei die‐<br />
sem Nachdenken bietet sich e<strong>in</strong>e Differenzierung an, wie sie im Kontext der Debatten um die<br />
soziale Konstruktion von <strong>Landschaften</strong> (vgl. GAILING 2012) e<strong>in</strong>e Rolle spielt. Demnach kann<br />
man im Prozess der Konstruktion von <strong>Landschaften</strong> unterscheiden zwischen:<br />
1. dem physisch‐materiellen Aspekt von Landschaft: „Landschaft“ wäre demnach e<strong>in</strong>e Chif‐<br />
fre für jede physisch‐materielle, räumliche Gegebenheit, die durch beabsichtigte oder un‐<br />
beabsichtigte menschliche oder nicht‐menschliche Aktivität verändert wurde und wird.<br />
Sie ist das physisch‐materielle, objekthafte (Zwischen)resultat komplexer sozio‐<br />
ökologischer Prozesse der Aneignung, der Nutzung und der Veränderung nicht‐<br />
anthropogener Ressourcen. „Landschaft“ ist <strong>in</strong> diesem S<strong>in</strong>ne das je <strong>in</strong>dividuelle Ergebnis<br />
der Mensch‐Natur‐Ause<strong>in</strong>andersetzung (vgl. AITCHISON et al. 2002) und als solche e<strong>in</strong>e<br />
konkrete, gegenständliche physisch‐materielle Realität.<br />
2. die Ebene der Ontologisierung e<strong>in</strong>zelner <strong>Landschaften</strong>: aus der Fülle physisch‐materieller<br />
Angebote werden <strong>in</strong> langfristigen gesellschaftlichen Prozessen e<strong>in</strong>zelne <strong>Landschaften</strong><br />
konstruiert. „Ontologisierung“ me<strong>in</strong>t: das Dase<strong>in</strong> dieser Raume<strong>in</strong>heiten wird unabhän‐<br />
gig von e<strong>in</strong>em <strong>in</strong>dividuellen Standpunkt relativ unh<strong>in</strong>terfragt h<strong>in</strong>genommen (vgl.<br />
SCHLOTTMANN 2005: 181). Wesentliche Bed<strong>in</strong>gung für e<strong>in</strong>e erfolgreiche Ontologisierung<br />
ist die erfolgreiche Verdrängung des Konstruktcharakters: es ist beispielsweise für die<br />
meisten Menschen normal, das e<strong>in</strong> ganz bestimmter Raumausschnitt geme<strong>in</strong>t ist, wenn<br />
von dem „Spreewald“, dem „Alten Land“ oder der „Eifel“ die Rede ist. E<strong>in</strong>e wesentliche<br />
Rolle spielen gesellschaftlich verhandelte und/oder akzeptierte Kriterien der Homogeni‐<br />
tät e<strong>in</strong>er Landschaft wie „Eigenart“, „E<strong>in</strong>heit von Land und Leuten“, „eigenständiger<br />
Charakter“, „Alle<strong>in</strong>stellungsmerkmale“, „Aura“ o. ä. Mit jedem Text oder Bild zu bzw.<br />
mit jeder verbalen Kommunikation über e<strong>in</strong>e besondere Landschaft wird ihre Ontologi‐<br />
34