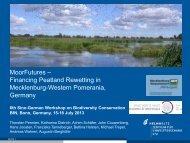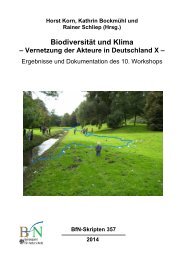Landschaften in Deutschland 2030 Erlittener Wandel – gestalteter ...
Landschaften in Deutschland 2030 Erlittener Wandel – gestalteter ...
Landschaften in Deutschland 2030 Erlittener Wandel – gestalteter ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Landschaften</strong> <strong>in</strong> <strong>Deutschland</strong> <strong>2030</strong>: <strong>Erlittener</strong> <strong>Wandel</strong> <strong>–</strong> <strong>gestalteter</strong> <strong>Wandel</strong><br />
festgelegt, wie z. B. 2 % der Landesfläche für W<strong>in</strong>dkraft bereit zu stellen (z. B. Umweltm<strong>in</strong>i‐<br />
sterium NW). Dabei sollen <strong>in</strong> e<strong>in</strong>igen Bundesländern auch Waldflächen aktiv <strong>in</strong> die Standort‐<br />
suche e<strong>in</strong>bezogen werden (Bayern, Baden‐Württemberg) oder auch beispielsweise <strong>in</strong> Bayern<br />
Landschaftsschutzgebiete grundsätzlich für die W<strong>in</strong>dkraftnutzung geöffnet werden. Gerade<br />
<strong>in</strong> den B<strong>in</strong>nenländern werden zudem Kuppenlagen und exponierte Standorte, auf Grund ih‐<br />
rer höheren W<strong>in</strong>dausbeute, diskutiert. Damit dürfte die W<strong>in</strong>dkraft <strong>in</strong> den nächsten Jahren<br />
auch h<strong>in</strong>sichtlich ihrer Wahrnehmbarkeit <strong>in</strong> der Landschaft deutlich an Bedeutung gew<strong>in</strong>nen.<br />
E<strong>in</strong>e Studie des Fraunhofer‐Instituts IWES kam im März 2011 u. a. zu dem Ergebnis, dass <strong>in</strong><br />
<strong>Deutschland</strong> auf der Basis von Geodaten knapp 8 % der Landfläche außerhalb von Wäldern<br />
und Schutzgebieten zur Verfügung stünden. Daher sei e<strong>in</strong> Ziel von 2 % der Landesfläche als<br />
realistisch für e<strong>in</strong>e Wndkraftnutzung e<strong>in</strong>zuschätzen (IWES 2011).<br />
Bei der Bewertung der Auswirkungen von W<strong>in</strong>dkraftnutzung auf der Landschaftsebene ist<br />
die Frage des Standortes ganz zentral. Bei der Wahl geeigneter Standorte kann e<strong>in</strong>e Vielzahl<br />
von Konflikten <strong>–</strong> mit Anwohnern (Sichtbarkeit, Lärm) und mit dem Naturschutz (Arten‐<br />
schutz, Landschaftsbild) <strong>–</strong> vermieden werden. Gleichzeitig stellt sich die Frage, wie viel W<strong>in</strong>‐<br />
denergie verträgt welche Landschaft?<br />
Diese Frage kann aus verschiedener Perspektive gestellt werden. Sie ist letztlich grundsätzlich<br />
auf gesellschaftlicher Ebene zu entscheiden. Denn die Landschaft unterlag immer e<strong>in</strong>em<br />
<strong>Wandel</strong> durch verschiedene Formen der Nutzung. Dann stellt sich allerd<strong>in</strong>gs die Frage, wie<br />
gesellschaftliche Me<strong>in</strong>ungsbildung stattf<strong>in</strong>det und wie sie wiederum <strong>in</strong> Ausbauraten umge‐<br />
setzt werden kann. E<strong>in</strong>e wesentliche Grundlage für diese Me<strong>in</strong>ungsbildung ist <strong>in</strong> jedem Fall<br />
e<strong>in</strong>e ausreichende Information über mögliche Entwicklungspfade und deren Folgen.<br />
Aus Naturschutzsicht kann und muss anhand der Kenntnisse zu den Auswirkungen e<strong>in</strong> we‐<br />
sentlicher Beitrag zur Debatte kommen. Diese Frage kann jedoch nicht alle<strong>in</strong> auf Landschafts‐<br />
ebene beantwortet werden, da neben Auswirkungen auf das Landschaftsbild durchaus auch<br />
z. B. e<strong>in</strong>zelne Artengruppen (z. B. e<strong>in</strong>ige Greifvogelarten und Fledermäuse) <strong>in</strong> besonderer<br />
Weise von dieser Form der Energiegew<strong>in</strong>nung betroffen s<strong>in</strong>d. Insbesondere regional kann die<br />
<strong>in</strong>tensive W<strong>in</strong>denergienutzung durchaus an artenschutzrechtliche Grenzen stoßen.<br />
Es gilt, die Kenntnisse zusammenzutragen und stetig zu verbessern. So bestehen z. B. zur<br />
W<strong>in</strong>dkraftnutzung im Wald noch erhebliche Kenntnislücken. Ergebnisse aus Monitor<strong>in</strong>g und<br />
Felduntersuchungen s<strong>in</strong>d dann, z. B. über Kriterien für die Standortwahl <strong>in</strong> die Planungspro‐<br />
zesse e<strong>in</strong>zuspeisen sowie über Maßgaben zur technischen Ausgestaltung der Anlagen und zu<br />
deren Management im Genehmigungsverfahren, umzusetzen (z. B. Abschaltalgorithmen).<br />
3.2 Biomasse<br />
Verschiedene Szenarien kommen zu dem Ergebnis, dass bis zu 4,2 Mio. ha für den Anbau<br />
nachwachsender Rohstoffe genutzt werden können. Im Nationalen Biomasseaktionsplan<br />
(BMWLV u. a. 2010) wird angenommen, dass 2020 2,5‐4 Mio. ha Ackerfläche für die stoffliche<br />
und energetische Nutzung zur Verfügung stehen können. Zwar werden unterschiedliche<br />
Nutzungspfade der Biomasse mehr oder weniger erfolgreich angereizt, z. B. über die Festle‐<br />
gung e<strong>in</strong>er Biokraftstoffquote (E10) oder über die Festsetzung von E<strong>in</strong>speisevergütungssätzen<br />
im EEG z. B. für Biogas. Es fehlt jedoch e<strong>in</strong>e flächen‐ und mengenbezogene Diskussion dar‐<br />
über, wie die zur Verfügung stehende Fläche primär genutzt werden sollte, zum Anbau von<br />
ölhaltigen Pflanzen, von Biogassubstraten, für holzartige Biomassen oder gar zur stofflichen<br />
Verwertung. Allerd<strong>in</strong>gs hängt die Anbauentscheidung letztlich natürlich sehr stark vom<br />
Landwirt selbst ab. Damit ist sie nur bed<strong>in</strong>gt steuerbar, sondern vielmehr auch sehr eng an<br />
52