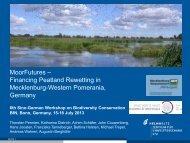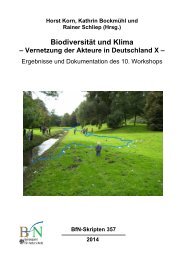Landschaften in Deutschland 2030 Erlittener Wandel – gestalteter ...
Landschaften in Deutschland 2030 Erlittener Wandel – gestalteter ...
Landschaften in Deutschland 2030 Erlittener Wandel – gestalteter ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Landschaften</strong> <strong>in</strong> <strong>Deutschland</strong> <strong>2030</strong>: <strong>Erlittener</strong> <strong>Wandel</strong> <strong>–</strong> <strong>gestalteter</strong> <strong>Wandel</strong><br />
schw<strong>in</strong>den von real (körperlich) erfahrbaren Widerständen <strong>in</strong> den virtuellen Erlebniswelten<br />
der Computerspiele u. a. die s<strong>in</strong>nliche Erfahrung, Empathie oder auch die Präferenzen <strong>in</strong> der<br />
Wahrnehmung der Computerspieler grundsätzlich m<strong>in</strong>dere, da e<strong>in</strong>erseits das aktiv Tätige<br />
und die Begegnung mit Anderen und mit etwas Anderem wie z. B. der Natur <strong>–</strong> verstanden<br />
als Formen der Realitätskontrolle <strong>–</strong> nicht vorhanden sei (FUCHS 2010). Idealtypisch für diese<br />
Position diagnostiziert THOMAS FUCHS (2010) aus theoretischer Perspektive e<strong>in</strong>e dysfunktio‐<br />
nale Entkörperung der Erfahrung (Disembodiment) im Rahmen „virtueller Realitäten”. Diese<br />
sei aus phänomologischer Perspektive<br />
1. als e<strong>in</strong>e Ents<strong>in</strong>nlichung persönlicher Erfahrungen,<br />
2. e<strong>in</strong>e Phantomisierung der Wirklichkeit und<br />
3. e<strong>in</strong>e Sche<strong>in</strong>präsenz des Menschen charakterisierbar, was grundsätzlich u. a. der Such‐<br />
tentwicklung und nicht‐sozialer wie unrealistischer E<strong>in</strong>stellungen Vorschub leiste.<br />
Aus kommunikationswissenschaftlicher Sicht ersche<strong>in</strong>en diese Blickw<strong>in</strong>kel e<strong>in</strong>geschränkt,<br />
denn h<strong>in</strong>ter dem Begriff und der Medientechnologie „virtuelle Welten“ verbergen sich e<strong>in</strong><br />
weitaus facettenreicheres und damit komplexeres Kommunikations‐ und Medienphänomen,<br />
dass nicht alle<strong>in</strong> auf die vermutete kanalreduzierende Wirkmächtigkeit der medientechnolo‐<br />
gischen Grundstruktur reduziert werden kann. Computerspielwelten bieten dem Spieler z. T.<br />
e<strong>in</strong>e komplexe Erfahrungsstruktur, die neben der Spiellogik und Spielerlebnis stets auch auf<br />
repräsentationelle Aspekte wie z. B. der Darstellung natürlicher Umgebungen verweist<br />
(MÄYRÄ 2009). Diese Struktur ist allerd<strong>in</strong>gs nicht isoliert zu betrachten, sondern wird erst<br />
durch die Spielhandlungen der Spieler erfahrbar und damit letztendlich durch die Praktiken<br />
der Spieler analytisch nachvollziehbar.<br />
Die <strong>in</strong> den mediatisierten Erlebniswelten der Onl<strong>in</strong>e‐Computerspiele stattf<strong>in</strong>denden Prozesse<br />
der Information, Interaktion und Kommunikation gehen nun über re<strong>in</strong>e „Mensch‐Masch<strong>in</strong>e‐<br />
Interaktionen” h<strong>in</strong>aus und lassen Computerspiele auch als Kommunikationsmedien verste‐<br />
hen. Folgerichtig ist daher danach zu fragen, welche soziale und kulturelle, also s<strong>in</strong>nstiftende<br />
Bedeutung Computerspiele haben und wie diese zustande kommt (vgl. KROTZ 2008). Die Ent‐<br />
stehung der S<strong>in</strong>nstiftung und das zugehörige Zusammenspiel der S<strong>in</strong>ne ersche<strong>in</strong>en <strong>in</strong> den<br />
Computerspielwelten auf den ersten Blick naturgemäß stark losgelöst von der direkten Betei‐<br />
ligung des personalen Körpers, sondern eher vom Bedeutungsgehalt der spezifischen virtuel‐<br />
len Welt, deren Spielregeln und den dar<strong>in</strong> stattf<strong>in</strong>denden virtuellen Spielhandlungen deter‐<br />
m<strong>in</strong>iert.<br />
Der Blick auf die Medienkultur des Computerspielens und der dar<strong>in</strong> zum Ausdruck kom‐<br />
mende alltägliche Umgang mit Computerspielen kann dazu beitragen, diese komplexen Kon‐<br />
struktionsprozesse besser zu verstehen, gleichwohl wir noch sehr wenig über die höchst un‐<br />
terschiedlichen Computerspielkulturen wissen. Diesem Paradigma folgende mediensozio‐<br />
logische Untersuchungen zeigen mehrerlei: Aktuell populäre Computerspielwelten wie z. B.<br />
World of Warcraft, Counter‐Strike oder Second Life bee<strong>in</strong>flussen bed<strong>in</strong>gt durch ihr Interak‐<br />
tions‐ und Interaktivitätspotenzial nicht nur die Alltagswelt und Identitätsprozesse ihrer Spie‐<br />
ler. Auch wenn die Begegnungen zwischen den Spielern oftmals re<strong>in</strong> medienvermittelt und<br />
ohne körperlich erfahrbare Begegnungen <strong>in</strong> realiter stattf<strong>in</strong>den, sorgen über das Spielen h<strong>in</strong>‐<br />
aus die mitunter recht unterschiedlichen und ausdifferenzierten Kommunikationsmöglichkei‐<br />
ten, die sich den Spielern bieten, für realweltliche Lern‐ und Vergeme<strong>in</strong>schaftungsprozesse.<br />
Die Mehrheit der Computerspielwelten ist darüber h<strong>in</strong>aus <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er weltweiten, vielschichti‐<br />
gen und zumeist oft nur virtuellen, da größtenteils alle<strong>in</strong> medienvermittelten, Spielkultur<br />
verwurzelt. Sie stellen <strong>in</strong> ihren spezifischen Regelkontexten nicht nur verschiedene mediati‐<br />
sierte Spielwelten für Spaß, Wettkampf, Leistung etc. dar, sondern s<strong>in</strong>d auch als soziale Räu‐<br />
me u. a. für Kontakte, Kollaboration etc. und als virtuelle Erlebniswelten, denen verschiedene<br />
18