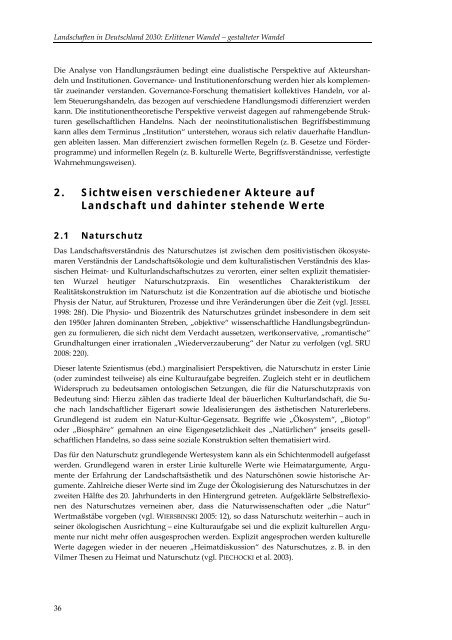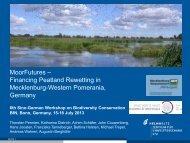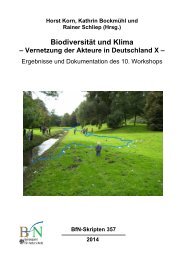Landschaften in Deutschland 2030 Erlittener Wandel – gestalteter ...
Landschaften in Deutschland 2030 Erlittener Wandel – gestalteter ...
Landschaften in Deutschland 2030 Erlittener Wandel – gestalteter ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Landschaften</strong> <strong>in</strong> <strong>Deutschland</strong> <strong>2030</strong>: <strong>Erlittener</strong> <strong>Wandel</strong> <strong>–</strong> <strong>gestalteter</strong> <strong>Wandel</strong><br />
Die Analyse von Handlungsräumen bed<strong>in</strong>gt e<strong>in</strong>e dualistische Perspektive auf Akteurshan‐<br />
deln und Institutionen. Governance‐ und Institutionenforschung werden hier als komplemen‐<br />
tär zue<strong>in</strong>ander verstanden. Governance‐Forschung thematisiert kollektives Handeln, vor al‐<br />
lem Steuerungshandeln, das bezogen auf verschiedene Handlungsmodi differenziert werden<br />
kann. Die <strong>in</strong>stitutionentheoretische Perspektive verweist dagegen auf rahmengebende Struk‐<br />
turen gesellschaftlichen Handelns. Nach der neo<strong>in</strong>stitutionalistischen Begriffsbestimmung<br />
kann alles dem Term<strong>in</strong>us „Institution“ unterstehen, woraus sich relativ dauerhafte Handlun‐<br />
gen ableiten lassen. Man differenziert zwischen formellen Regeln (z. B. Gesetze und Förder‐<br />
programme) und <strong>in</strong>formellen Regeln (z. B. kulturelle Werte, Begriffsverständnisse, verfestigte<br />
Wahrnehmungsweisen).<br />
2. Sichtweisen verschiedener Akteure auf<br />
Landschaft und dah<strong>in</strong>ter stehende Werte<br />
2.1 Naturschutz<br />
Das Landschaftsverständnis des Naturschutzes ist zwischen dem positivistischen ökosyste‐<br />
maren Verständnis der Landschaftsökologie und dem kulturalistischen Verständnis des klas‐<br />
sischen Heimat‐ und Kulturlandschaftschutzes zu verorten, e<strong>in</strong>er selten explizit thematisier‐<br />
ten Wurzel heutiger Naturschutzpraxis. E<strong>in</strong> wesentliches Charakteristikum der<br />
Realitätskonstruktion im Naturschutz ist die Konzentration auf die abiotische und biotische<br />
Physis der Natur, auf Strukturen, Prozesse und ihre Veränderungen über die Zeit (vgl. JESSEL<br />
1998: 28f). Die Physio‐ und Biozentrik des Naturschutzes gründet <strong>in</strong>sbesondere <strong>in</strong> dem seit<br />
den 1950er Jahren dom<strong>in</strong>anten Streben, „objektive“ wissenschaftliche Handlungsbegründun‐<br />
gen zu formulieren, die sich nicht dem Verdacht aussetzen, wertkonservative, „romantische“<br />
Grundhaltungen e<strong>in</strong>er irrationalen „Wiederverzauberung“ der Natur zu verfolgen (vgl. SRU<br />
2008: 220).<br />
Dieser latente Szientismus (ebd.) marg<strong>in</strong>alisiert Perspektiven, die Naturschutz <strong>in</strong> erster L<strong>in</strong>ie<br />
(oder zum<strong>in</strong>dest teilweise) als e<strong>in</strong>e Kulturaufgabe begreifen. Zugleich steht er <strong>in</strong> deutlichem<br />
Widerspruch zu bedeutsamen ontologischen Setzungen, die für die Naturschutzpraxis von<br />
Bedeutung s<strong>in</strong>d: Hierzu zählen das tradierte Ideal der bäuerlichen Kulturlandschaft, die Su‐<br />
che nach landschaftlicher Eigenart sowie Idealisierungen des ästhetischen Naturerlebens.<br />
Grundlegend ist zudem e<strong>in</strong> Natur‐Kultur‐Gegensatz. Begriffe wie „Ökosystem“, „Biotop“<br />
oder „Biosphäre“ gemahnen an e<strong>in</strong>e Eigengesetzlichkeit des „Natürlichen“ jenseits gesell‐<br />
schaftlichen Handelns, so dass se<strong>in</strong>e soziale Konstruktion selten thematisiert wird.<br />
Das für den Naturschutz grundlegende Wertesystem kann als e<strong>in</strong> Schichtenmodell aufgefasst<br />
werden. Grundlegend waren <strong>in</strong> erster L<strong>in</strong>ie kulturelle Werte wie Heimatargumente, Argu‐<br />
mente der Erfahrung der Landschaftsästhetik und des Naturschönen sowie historische Ar‐<br />
gumente. Zahlreiche dieser Werte s<strong>in</strong>d im Zuge der Ökologisierung des Naturschutzes <strong>in</strong> der<br />
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts <strong>in</strong> den H<strong>in</strong>tergrund getreten. Aufgeklärte Selbstreflexio‐<br />
nen des Naturschutzes verne<strong>in</strong>en aber, dass die Naturwissenschaften oder „die Natur“<br />
Wertmaßstäbe vorgeben (vgl. WIERSBINSKI 2005: 12), so dass Naturschutz weiterh<strong>in</strong> <strong>–</strong> auch <strong>in</strong><br />
se<strong>in</strong>er ökologischen Ausrichtung <strong>–</strong> e<strong>in</strong>e Kulturaufgabe sei und die explizit kulturellen Argu‐<br />
mente nur nicht mehr offen ausgesprochen werden. Explizit angesprochen werden kulturelle<br />
Werte dagegen wieder <strong>in</strong> der neueren „Heimatdiskussion“ des Naturschutzes, z. B. <strong>in</strong> den<br />
Vilmer Thesen zu Heimat und Naturschutz (vgl. PIECHOCKI et al. 2003).<br />
36