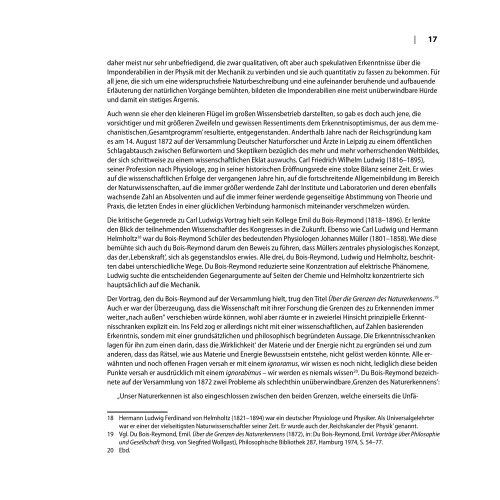ZWISCHEN PHILOSOPHIE UND SPIRITISMUS
ZWISCHEN PHILOSOPHIE UND SPIRITISMUS
ZWISCHEN PHILOSOPHIE UND SPIRITISMUS
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
| 17<br />
daher meist nur sehr unbefriedigend, die zwar qualitativen, oft aber auch spekulativen Erkenntnisse über die<br />
Imponderabilien in der Physik mit der Mechanik zu verbinden und sie auch quantitativ zu fassen zu bekommen. Für<br />
all jene, die sich um eine widerspruchsfreie Naturbeschreibung und eine aufeinander beruhende und aufbauende<br />
Erläuterung der natürlichen Vorgänge bemühten, bildeten die Imponderabilien eine meist unüberwindbare Hürde<br />
und damit ein stetiges Ärgernis.<br />
Auch wenn sie eher den kleineren Flügel im großen Wissensbetrieb darstellten, so gab es doch auch jene, die<br />
vorsichtiger und mit größeren Zweifeln und gewissen Ressentiments dem Erkenntnisoptimismus, der aus dem mechanistischen<br />
‚Gesamtprogramm’ resultierte, entgegenstanden. Anderthalb Jahre nach der Reichsgründung kam<br />
es am 14. August 1872 auf der Versammlung Deutscher Naturforscher und Ärzte in Leipzig zu einem öffentlichen<br />
Schlagabtausch zwischen Befürwortern und Skeptikern bezüglich des mehr und mehr vorherrschenden Weltbildes,<br />
der sich schrittweise zu einem wissenschaftlichen Eklat auswuchs. Carl Friedrich Wilhelm Ludwig (1816–1895),<br />
seiner Profession nach Physiologe, zog in seiner historischen Eröffnungsrede eine stolze Bilanz seiner Zeit. Er wies<br />
auf die wissenschaftlichen Erfolge der vergangenen Jahre hin, auf die fortschreitende Allgemeinbildung im Bereich<br />
der Naturwissenschaften, auf die immer größer werdende Zahl der Institute und Laboratorien und deren ebenfalls<br />
wachsende Zahl an Absolventen und auf die immer feiner werdende gegenseitige Abstimmung von Theorie und<br />
Praxis, die letzten Endes in einer glücklichen Verbindung harmonisch miteinander verschmelzen würden.<br />
Die kritische Gegenrede zu Carl Ludwigs Vortrag hielt sein Kollege Emil du Bois-Reymond (1818–1896). Er lenkte<br />
den Blick der teilnehmenden Wissenschaftler des Kongresses in die Zukunft. Ebenso wie Carl Ludwig und Hermann<br />
Helmholtz18 war du Bois-Reymond Schüler des bedeutenden Physiologen Johannes Müller (1801–1858). Wie diese<br />
bemühte sich auch du Bois-Reymond darum den Beweis zu führen, dass Müllers zentrales physiologisches Konzept,<br />
das der ‚Lebenskraft‘, sich als gegenstandslos erwies. Alle drei, du Bois-Reymond, Ludwig und Helmholtz, beschritten<br />
dabei unterschiedliche Wege. Du Bois-Reymond reduzierte seine Konzentration auf elektrische Phänomene,<br />
Ludwig suchte die entscheidenden Gegenargumente auf Seiten der Chemie und Helmholtz konzentrierte sich<br />
hauptsächlich auf die Mechanik.<br />
Der Vortrag, den du Bois-Reymond auf der Versammlung hielt, trug den Titel Über die Grenzen des Naturerkennens. 19<br />
Auch er war der Überzeugung, dass die Wissenschaft mit ihrer Forschung die Grenzen des zu Erkennenden immer<br />
weiter „nach außen“ verschieben würde können, wohl aber räumte er in zweierlei Hinsicht prinzipielle Erkenntnisschranken<br />
explizit ein. Ins Feld zog er allerdings nicht mit einer wissenschaftlichen, auf Zahlen basierenden<br />
Erkenntnis, sondern mit einer grundsätzlichen und philosophisch begründeten Aussage. Die Erkenntnisschranken<br />
lagen für ihn zum einen darin, dass die ‚Wirklichkeit‘ der Materie und der Energie nicht zu ergründen sei und zum<br />
anderen, dass das Rätsel, wie aus Materie und Energie Bewusstsein entstehe, nicht gelöst werden könnte. Alle erwähnten<br />
und noch offenen Fragen versah er mit einem ignoramus, wir wissen es noch nicht, lediglich diese beiden<br />
Punkte versah er ausdrücklich mit einem ignorabimus – wir werden es niemals wissen20 . Du Bois-Reymond bezeichnete<br />
auf der Versammlung von 1872 zwei Probleme als schlechthin unüberwindbare ‚Grenzen des Naturerkennens’:<br />
„Unser Naturerkennen ist also eingeschlossen zwischen den beiden Grenzen, welche einerseits die Unfä-<br />
18 Hermann Ludwig Ferdinand von Helmholtz (1821–1894) war ein deutscher Physiologe und Physiker. Als Universalgelehrter<br />
war er einer der vielseitigsten Naturwissenschaftler seiner Zeit. Er wurde auch der ‚Reichskanzler der Physik’ genannt.<br />
19 Vgl. Du Bois-Reymond, Emil. Über die Grenzen des Naturerkennens (1872), in: Du Bois-Reymond, Emil. Vorträge über Philosophie<br />
und Gesellschaft (hrsg. von Siegfried Wollgast), Philosophische Bibliothek 287, Hamburg 1974, S. 54–77.<br />
20 Ebd.