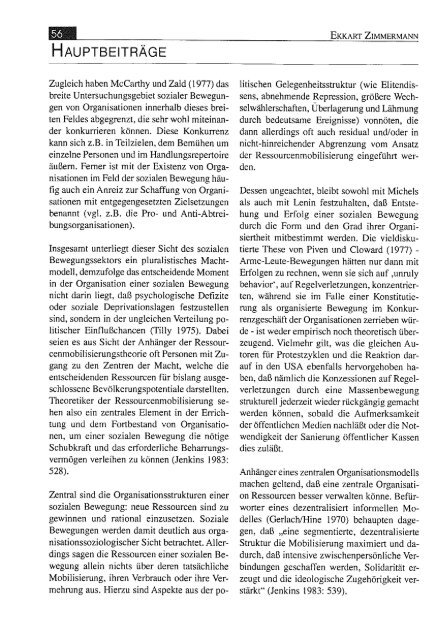Vollversion (5.41 MB) - Forschungsjournal Soziale Bewegungen
Vollversion (5.41 MB) - Forschungsjournal Soziale Bewegungen
Vollversion (5.41 MB) - Forschungsjournal Soziale Bewegungen
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
HAUPTBEITRÄGE<br />
Zugleich haben McCarthy und Zald (1977) das<br />
breite Untersuchungsgebiet sozialer <strong>Bewegungen</strong><br />
von Organisationen innerhalb dieses breiten<br />
Feldes abgegrenzt, die sehr wohl miteinander<br />
konkurrieren können. Diese Konkurrenz<br />
kann sich z.B. in Teilzielen, dem Bemühen um<br />
einzelne Personen und im Handlungsrepertoire<br />
äußern. Femer ist mit der Existenz von Organisationen<br />
im Feld der sozialen Bewegung häufig<br />
auch ein Anreiz zur Schaffung von Organisationen<br />
mit entgegengesetzten Zielsetzungen<br />
benannt (vgl. z.B. die Pro- und Anti-Abtreibungsorganisationen).<br />
Insgesamt unterliegt dieser Sicht des sozialen<br />
Bewegungssektors ein pluralistisches Machtmodell,<br />
demzufolge das entscheidende Moment<br />
in der Organisation einer sozialen Bewegung<br />
nicht darin liegt, daß psychologische Defizite<br />
oder soziale Deprivationslagen festzustellen<br />
sind, sondern in der ungleichen Verteilung politischer<br />
Einflußchancen (Tilly 1975). Dabei<br />
seien es aus Sicht der Anhänger der Ressourcenmobilisierungstheorie<br />
oft Personen mit Zugang<br />
zu den Zentren der Macht, welche die<br />
entscheidenden Ressourcen für bislang ausgeschlossene<br />
Bevölkerungspotentiale darstellten.<br />
Theoretiker der Ressourcenmobilisierung sehen<br />
also ein zentrales Element in der Errichtung<br />
und dem Fortbestand von Organisationen,<br />
um einer sozialen Bewegung die nötige<br />
Schubkraft und das erforderliche Beharrungsvermögen<br />
verleihen zu können (Jenkins 1983:<br />
528).<br />
Zentral sind die Organisationsstrukturen einer<br />
sozialen Bewegung: neue Ressourcen sind zu<br />
gewinnen und rational einzusetzen. <strong>Soziale</strong><br />
<strong>Bewegungen</strong> werden damit deutlich aus organisationssoziologischer<br />
Sicht betrachtet. Allerdings<br />
sagen die Ressourcen einer sozialen Bewegung<br />
allein nichts über deren tatsächliche<br />
Mobilisierung, ihren Verbrauch oder ihre Vermehrung<br />
aus. Hierzu sind Aspekte aus der po<br />
EKKART ZIMMERMANN<br />
litischen Gelegenheitsstruktur (wie Elitendissens,<br />
abnehmende Repression, größere Wechselwählerschaften,<br />
Überlagerung und Lähmung<br />
durch bedeutsame Ereignisse) vonnöten, die<br />
dann allerdings oft auch residual und/oder in<br />
nicht-hinreichender Abgrenzung vom Ansatz<br />
der Ressourcenmobilisierung eingeführt werden.<br />
Dessen ungeachtet, bleibt sowohl mit Michels<br />
als auch mit Lenin festzuhalten, daß Entstehung<br />
und Erfolg einer sozialen Bewegung<br />
durch die Form und den Grad ihrer Organisiertheit<br />
mitbestimmt werden. Die vieldiskutierte<br />
These von Piven und Cloward (1977) -<br />
Arme-Leute-<strong>Bewegungen</strong> hätten nur dann mit<br />
Erfolgen zu rechnen, wenn sie sich auf ,unruly<br />
behavior', auf Regelverletzungen, konzentrierten,<br />
während sie im Falle einer Konstitutierung<br />
als organisierte Bewegung im Konkurrenzgeschäft<br />
der Organisationen zerrieben würde<br />
- ist weder empirisch noch theoretisch überzeugend.<br />
Vielmehr gilt, was die gleichen Autoren<br />
für Protestzyklen und die Reaktion darauf<br />
in den USA ebenfalls hervorgehoben haben,<br />
daß nämlich die Konzessionen auf Regelverletzungen<br />
durch eine Massenbewegung<br />
strukturell jederzeit wieder rückgängig gemacht<br />
werden können, sobald die Aufmerksamkeit<br />
der öffentlichen Medien nachläßt oder die Notwendigkeit<br />
der Sanierung öffentlicher Kassen<br />
dies zuläßt.<br />
Anhängereines zentralen Organisationsmodells<br />
machen geltend, daß eine zentrale Organisation<br />
Ressourcen besser verwalten könne. Befürworter<br />
eines dezentralisiert informellen Modelles<br />
(Gerlach/Hine 1970) behaupten dagegen,<br />
daß „eine segmentierte, dezentralisierte<br />
Struktur die Mobilisierung maximiert und dadurch,<br />
daß intensive zwischenpersönliche Verbindungen<br />
geschaffen werden, Solidarität erzeugt<br />
und die ideologische Zugehörigkeit verstärkt"<br />
(Jenkins 1983: 539).