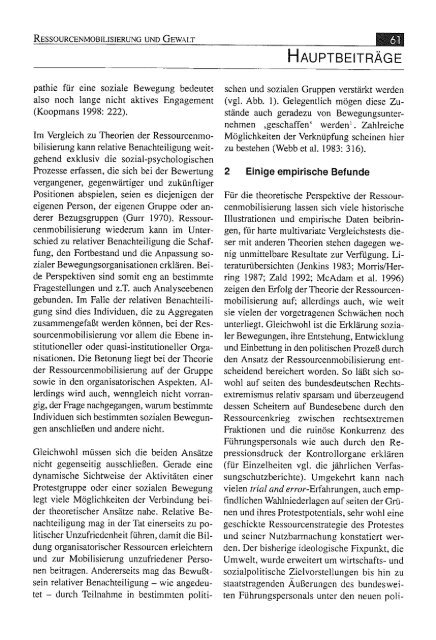Vollversion (5.41 MB) - Forschungsjournal Soziale Bewegungen
Vollversion (5.41 MB) - Forschungsjournal Soziale Bewegungen
Vollversion (5.41 MB) - Forschungsjournal Soziale Bewegungen
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
RESSOURCENMOBILISIERUNG UND GEWALT<br />
pathie für eine soziale Bewegung bedeutet<br />
also noch lange nicht aktives Engagement<br />
(Koopmans 1998: 222).<br />
Im Vergleich zu Theorien der Ressourcenmobilisierung<br />
kann relative Benachteiligung weitgehend<br />
exklusiv die sozial-psychologischen<br />
Prozesse erfassen, die sich bei der Bewertung<br />
vergangener, gegenwärtiger und zukünftiger<br />
Positionen abspielen, seien es diejenigen der<br />
eigenen Person, der eigenen Gruppe oder anderer<br />
Bezugsgruppen (Gurr 1970). Ressourcenmobilisierung<br />
wiederum kann im Unterschied<br />
zu relativer Benachteiligung die Schaffung,<br />
den Fortbestand und die Anpassung sozialer<br />
Bewegungsorganisationen erklären. Beide<br />
Perspektiven sind somit eng an bestimmte<br />
Fragestellungen und z.T. auch Analyseebenen<br />
gebunden. Im Falle der relativen Benachteiligung<br />
sind dies Individuen, die zu Aggregaten<br />
zusammengefaßt werden können, bei der Ressourcenmobilisierung<br />
vor allem die Ebene institutioneller<br />
oder quasi-institutioneller Organisationen.<br />
Die Betonung liegt bei der Theorie<br />
der Ressourcenmobilisierung auf der Gruppe<br />
sowie in den organisatorischen Aspekten. Allerdings<br />
wird auch, wenngleich nicht vorrangig,<br />
der Frage nachgegangen, warum bestimmte<br />
Individuen sich bestimmten sozialen <strong>Bewegungen</strong><br />
anschließen und andere nicht.<br />
Gleichwohl müssen sich die beiden Ansätze<br />
nicht gegenseitig ausschließen. Gerade eine<br />
dynamische Sichtweise der Aktivitäten einer<br />
Protestgruppe oder einer sozialen Bewegung<br />
legt viele Möglichkeiten der Verbindung beider<br />
theoretischer Ansätze nahe. Relative Benachteiligung<br />
mag in der Tat einerseits zu politischer<br />
Unzufriedenheit führen, damit die Bildung<br />
organisatorischer Ressourcen erleichtem<br />
und zur Mobilisierung unzufriedener Personen<br />
beitragen. Andererseits mag das Bewußtsein<br />
relativer Benachteiligung - wie angedeutet<br />
- durch Teilnahme in bestimmten politi-<br />
61<br />
HAUPTBEITRÄGE<br />
sehen und sozialen Gruppen verstärkt werden<br />
(vgl. Abb. 1). Gelegentlich mögen diese Zustände<br />
auch geradezu von Bewegungsunternehmen<br />
geschaffen' werden 1<br />
. Zahlreiche<br />
Möglichkeiten der Verknüpfung scheinen hier<br />
zu bestehen (Webb et al. 1983: 316).<br />
2 Einige empirische Befunde<br />
Für die theoretische Perspektive der Ressourcenmobilisierung<br />
lassen sich viele historische<br />
Illustrationen und empirische Daten beibringen,<br />
für harte multivariate Vergleichstests dieser<br />
mit anderen Theorien stehen dagegen wenig<br />
unmittelbare Resultate zur Verfügung. Literaturübersichten<br />
(Jenkins 1983; Morris/Herring<br />
1987; Zald 1992; McAdam et al. 1996)<br />
zeigen den Erfolg der Theorie der Ressourcenmobilisierung<br />
auf; allerdings auch, wie weit<br />
sie vielen der vorgetragenen Schwächen noch<br />
unterliegt. Gleichwohl ist die Erklärung sozialer<br />
<strong>Bewegungen</strong>, ihre Entstehung, Entwicklung<br />
und Einbettung in den politischen Prozeß durch<br />
den Ansatz der Ressourcenmobilisierung entscheidend<br />
bereichert worden. So läßt sich sowohl<br />
auf seiten des bundesdeutschen Rechtsextremismus<br />
relativ sparsam und überzeugend<br />
dessen Scheitern auf Bundesebene durch den<br />
Ressourcenkrieg zwischen rechtsextremen<br />
Fraktionen und die ruinöse Konkurrenz des<br />
Führungspersonals wie auch durch den Repressionsdruck<br />
der Kontrollorgane erklären<br />
(für Einzelheiten vgl. die jährlichen Verfassungschutzberichte).<br />
Umgekehrt kann nach<br />
vielen trial and error-Erfahrungen, auch empfindlichen<br />
Wahlniederlagen auf seiten der Grünen<br />
und ihres Protestpotentials, sehr wohl eine<br />
geschickte Ressourcenstrategie des Protestes<br />
und seiner Nutzbarmachung konstatiert werden.<br />
Der bisherige ideologische Fixpunkt, die<br />
Umwelt, wurde erweitert um wirtschafts- und<br />
sozialpolitische Zielvorstellungen bis hin zu<br />
staatstragenden Äußerungen des bundesweiten<br />
Führungspersonals unter den neuen poli-