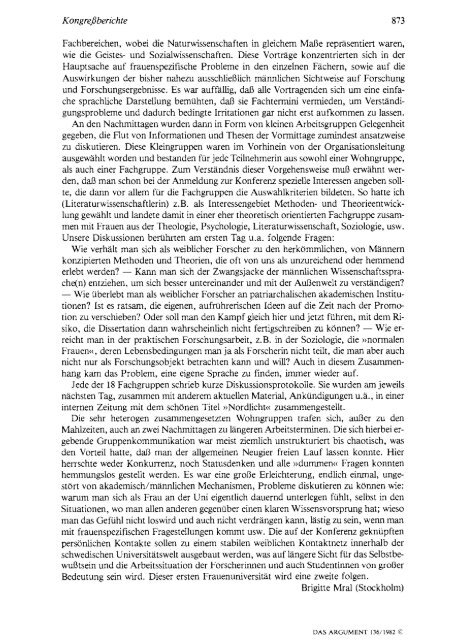Arbeitsteilung und Ideologie - Berliner Institut für kritische Theorie eV
Arbeitsteilung und Ideologie - Berliner Institut für kritische Theorie eV
Arbeitsteilung und Ideologie - Berliner Institut für kritische Theorie eV
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Kongreßberichte 873<br />
Fachbereichen, wobei die Naturwissenschaften in gleichem Maße repräsentiert waren,<br />
wie die Geistes- <strong>und</strong> Sozialwissenschaften. Diese Vorträge konzentrierten sich in der<br />
Hauptsache auf frauenspezifische Probleme in den einzelnen Fächern, sowie auf die<br />
Auswirkungen der bisher nahezu ausschließlich männlichen Sichtweise auf Forschung<br />
<strong>und</strong> Forschungsergebnisse. Es war auWillig, daß alle Vortragenden sich um eine einfache<br />
sprachliche Darstellung bemühten, daß sie Fachterrnini vermieden, um Verständigungsprobleme<br />
<strong>und</strong> dadurch bedingte Irritationen gar nicht erst aufkommen zu lassen.<br />
An den Nachmittagen wurden dann in Form von kleinen Arbeitsgruppen Gelegenheit<br />
gegeben, die Flut von Informationen <strong>und</strong> Thesen der Vormittage zumindest ansatzweise<br />
zu diskutieren. Diese Kleingruppen waren im Vorhinein von der Organisationsleitung<br />
ausgewählt worden <strong>und</strong> bestanden <strong>für</strong> jede Teilnehmerin aus sowohl einer Wohngruppe,<br />
als auch einer Fachgruppe. Zum Verständnis dieser Vorgehensweise muß erwähnt werden,<br />
daß man schon bei der Anmeldung zur Konferenz spezielle Interessen angeben sollte,<br />
die dann vor allem <strong>für</strong> die Fachgruppen die Auswahlkriterien bildeten. So hatte ich<br />
(Literaturwissenschaftlerin) z.B. als Interessengebiet Methoden- <strong>und</strong> <strong>Theorie</strong>entwicklung<br />
gewählt <strong>und</strong> landete damit in einer eher theoretisch orientierten Fachgruppe zusammen<br />
mit Frauen aus der Theologie, Psychologie, Literaturwissenschaft, Soziologie, usw.<br />
Unsere Diskussionen berührten am ersten Tag u.a. folgende Fragen:<br />
Wie verhält man sich als weiblicher Forscher zu den herkömmlichen, von Männern<br />
konzipierten Methoden <strong>und</strong> <strong>Theorie</strong>n, die oft von uns als unzureichend oder hemmend<br />
erlebt werden? - Kann man sich der Zwangsjacke der männlichen Wissenschaftssprache(n)<br />
entziehen, um sich besser untereinander <strong>und</strong> mit der Außenwelt zu verständigen?<br />
- Wie überlebt man als weiblicher Forscher an patriarchalischen akademischen <strong>Institut</strong>ionen?<br />
Ist es ratsam, die eigenen, aufrührerischen Ideen auf die Zeit nach der Promotion<br />
zu verschieben? Oder soll man den Kampf gleich hier <strong>und</strong> jetzt führen, mit dem Risiko,<br />
die Dissertation dann wahrscheinlich nicht fertigschreiben zu können? - Wie erreicht<br />
man in der praktischen Forschungsarbeit, z.B. in der Soziologie, die »normalen<br />
Frauen«, deren Lebensbedingungen man ja als Forscherin nicht teilt, die man aber auch<br />
nicht nur als Forschungsobjekt betrachten kann <strong>und</strong> will? Auch in diesem Zusammenhang<br />
kam das Problem, eine eigene Sprache zu finden, immer wieder auf.<br />
Jede der 18 Fachgruppen schrieb kurze Diskussionsprotokolle. Sie wurden am jeweils<br />
nächsten Tag, zusammen mit anderem aktuellen Material, Ankündigungen u.ä., in einer<br />
internen Zeitung mit dem schönen Titel »Nordlicht« zusammengestellt.<br />
Die sehr heterogen zusammengesetzten Wohngruppen trafen sich, außer zu den<br />
Mahlzeiten, auch an zwei Nachmittagen zu längeren Arbeitsterminen. Die sich hierbei ergebende<br />
Gruppenkommunikation war meist ziemlich unstrukturiert bis chaotisch, was<br />
den Vorteil hatte, daß man der allgemeinen Neugier freien Lauf lassen konnte. Hier<br />
herrschte weder Konkurrenz, noch Statusdenken <strong>und</strong> alle »dummen« Fragen konnten<br />
hemmungslos gestellt werden. Es war eine große Erleichterung, endlich einmal, ungestört<br />
von akademisch/männlichen Mechanismen, Probleme diskutieren zu können wie:<br />
warum man sich als Frau an der Uni eigentlich dauernd unterlegen fühlt, selbst in den<br />
Situationen, wo man allen anderen gegenüber einen klaren Wissensvorsprung hat; wieso<br />
man das Gefühl nicht loswird <strong>und</strong> auch nicht verdrängen kann, lästig zu sein, wenn man<br />
mit frauenspezifischen Fragestellungen kommt usw. Die auf der Konferenz geknüpften<br />
persönlichen Kontakte sollen zu einem stabilen weiblichen Kontaktnetz innerhalb der<br />
schwedischen Universitätswelt ausgebaut werden, was auf längere Sicht <strong>für</strong> das Selbstbewußtsein<br />
<strong>und</strong> die Arbeitssituation der Forscherinnen <strong>und</strong> auch Studentinnen von großer<br />
Bedeutung sein wird. Dieser ersten Frauenuniversität wird eine zweite folgen.<br />
Brigitte Mral (Stockholm)<br />
DAS ARGUMENT 136/1982 ©