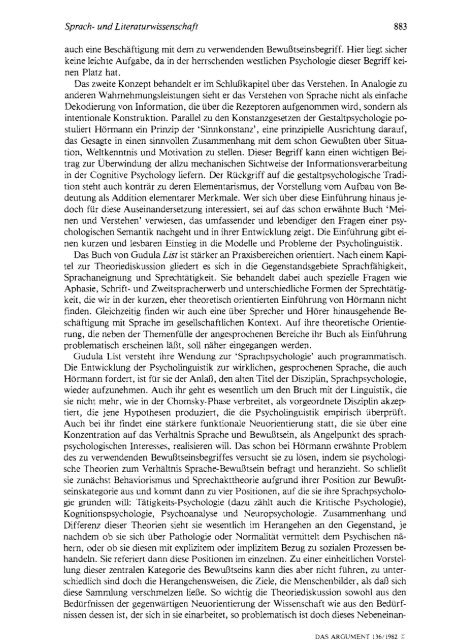Arbeitsteilung und Ideologie - Berliner Institut für kritische Theorie eV
Arbeitsteilung und Ideologie - Berliner Institut für kritische Theorie eV
Arbeitsteilung und Ideologie - Berliner Institut für kritische Theorie eV
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
DAS ARGUMENT 136/1982'"<br />
Sprach- <strong>und</strong> Literaturwissenschaft 883<br />
auch eine Beschäftigung mit dem zu verwendenden Bewußtseinsbegriff. Hier liegt sicher<br />
keine leichte Aufgabe, da in der herrschenden westlichen Psychologie dieser Begriff keinen<br />
Platz hat.<br />
Das zweite Konzept behandelt er im Schlußkapitel über das Verstehen. In Analogie zu<br />
anderen Wahrnehmungsleistungen sieht er das Verstehen von Sprache nicht als einfache<br />
Dekodierung von Information, die über die Rezeptoren aufgenommen wird, sondern als<br />
intentionale Konstruktion. Parallel zu den Konstanzgesetzen der Gestaltpsychologie postuliert<br />
Hörmann ein Prinzip der 'Sinnkonstanz' , eine prinzipielle Ausrichtung darauf,<br />
das Gesagte in einen sinnvollen Zusammenhang mit dem schon Gewußten über Situation,<br />
Weltkenntnis <strong>und</strong> Motivation zu stellen. Dieser Begriff kann einen wichtigen Beitrag<br />
zur Überwindung der allzu mechanischen Sichtweise der Informationsverarbeitung<br />
in der Cognitive Psychology liefern. Der Rückgriff auf die gestaltpsychologische Tradition<br />
steht auch konträr zu deren Elementarismus, der Vorstellung vom Aufbau von Bedeutung<br />
als Addition elementarer Merkmale. Wer sich über diese Einführung hinaus jedoch<br />
<strong>für</strong> diese Auseinandersetzung interessiert, sei auf das schon erwähnte Buch 'Meinen<br />
<strong>und</strong> Verstehen' verwiesen, das umfassender <strong>und</strong> lebendiger den Fragen einer psychologischen<br />
Semantik nachgeht <strong>und</strong> in ihrer Entwicklung zeigt. Die Einführung gibt einen<br />
kurzen <strong>und</strong> lesbaren Einstieg in die Modelle <strong>und</strong> Probleme der Psycholinguistik.<br />
Das Buch von Gudula List ist stärker an Praxisbereichen orientiert. Nach einem Kapitel<br />
zur <strong>Theorie</strong>diskussion gliedert es sich in die Gegenstandsgebiete Sprachfahigkeit,<br />
Sprachaneignung <strong>und</strong> Sprechtätigkeit. Sie behandelt dabei auch spezielle Fragen wie<br />
Aphasie, Schrift- <strong>und</strong> Zweitspracherwerb <strong>und</strong> unterschiedliche Formen der Sprechtätigkeit,<br />
die wir in der kurzen, eher theoretisch orientierten Einführung von Hörmann nicht<br />
finden. Gleichzeitig finden wir auch eine über Sprecher <strong>und</strong> Hörer hinausgehende Beschäftigung<br />
mit Sprache im gesellschaftlichen Kontext. Auf ihre theoretische Orientierung,<br />
die neben der Themenfülle der angesprochenen Bereiche ihr Buch als Einführung<br />
problematisch erscheinen läßt, soll näher eingegangen werden.<br />
Gudula List versteht ihre Wendung zur 'Sprachpsychologie' auch programmatisch.<br />
Die Entwicklung der Psycholinguistik zur wirklichen, gesprochenen Sprache, die auch<br />
Hörmann fordert, ist <strong>für</strong> sie der Anlaß, den alten Titel der Disziplin, Sprachpsychologie,<br />
wieder aufzunehmen. Auch ihr geht es wesentlich um den Bruch mit der Linguistik, die<br />
sie nicht mehr, wie in der Chomsky-Phase verbreitet, als vorgeordnete Disziplin akzeptiert,<br />
die jene Hypothesen produziert, die die Psycholinguistik empirisch überprüft.<br />
Auch bei ihr findet eine stärkere funktionale Neuorientierung statt, die sie über eine<br />
Konzentration auf das Verhältnis Sprache <strong>und</strong> Bewußtsein, als Angelpunkt des sprachpsychologischen<br />
Interesses, realisieren will. Das schon bei Hörmann erwähnte Problem<br />
des zu verwendenden Bewußtseinsbegriffes versucht sie zu lösen, indem sie psychologische<br />
<strong>Theorie</strong>n zum Verhältnis Sprache-Bewußtsein befragt <strong>und</strong> heranzieht. So schließt<br />
sie zunächst Behaviorismus <strong>und</strong> Sprechakttheorie aufgr<strong>und</strong> ihrer Position zur Bewußtseinskategorie<br />
aus <strong>und</strong> kommt dann zu vier Positionen, auf die sie ihre Sprachpsychologie<br />
gründen will: Tätigkeits-Psychologie (dazu zählt auch die Kritische Psychologie),<br />
Kognitionspsychologie, Psychoanalyse <strong>und</strong> Neuropsychologie. Zusammenhang <strong>und</strong><br />
Differenz dieser <strong>Theorie</strong>n sieht sie wesentlich im Herangehen an den Gegenstand, je<br />
nachdem ob sie sich über Pathologie oder Normalität vermittelt dem Psychischen nähern,<br />
oder ob sie diesen mit explizitem oder implizitem Bezug zu sozialen Prozessen behandeln.<br />
Sie referiert dann diese Positionen im einzelnen. Zu einer einheitlichen Vorstellung<br />
dieser zentralen Kategorie des Bewußtseins kann dies aber nicht führen, zu unterschiedlich<br />
sind doch die Herangehensweisen, die Ziele, die Menschenbilder , als daß sich<br />
diese Sammlung verschmelzen ließe. So wichtig die <strong>Theorie</strong>diskussion sowohl aus den<br />
Bedürfnissen der gegenwärtigen Neuorientierung der Wissenschaft wie aus den Bedürfnissen<br />
dessen ist, der sich in sie einarbeitet, so problematisch ist doch dieses Nebeneinan-