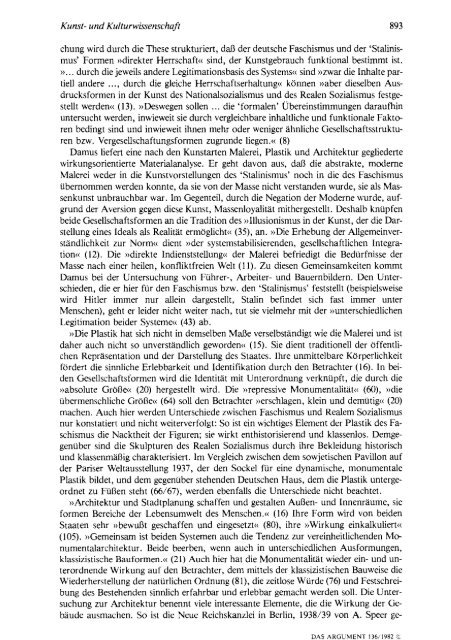Arbeitsteilung und Ideologie - Berliner Institut für kritische Theorie eV
Arbeitsteilung und Ideologie - Berliner Institut für kritische Theorie eV
Arbeitsteilung und Ideologie - Berliner Institut für kritische Theorie eV
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
DAS ARGUMENT 136/1982<br />
Kunst- <strong>und</strong> Kulturwissenschajt 893<br />
chung wird durch die These strukturiert, daß der deutsche Faschismus <strong>und</strong> der 'Stalinismus'<br />
Formen »direkter Herrschaft« sind, der Kunstgebrauch funktional bestimmt ist.<br />
» ... durch die jeweils andere Legitimationsbasis des Systems« sind »zwar die Inhalte partiell<br />
andere ... , durch die gleiche Herrschaftserhaltung« können »aber dieselben Ausdrucksformen<br />
in der Kunst des Nationalsozialismus <strong>und</strong> des Realen Sozialismus festgestellt<br />
werden« (13). »Deswegen sollen ... die 'formalen' Übereinstimmungen daraufhin<br />
untersucht werden, inwieweit sie durch vergleichbare inhaltliche <strong>und</strong> funktionale Faktoren<br />
bedingt sind <strong>und</strong> inwieweit ihnen mehr oder weniger ähnliche Gesellschaftsstrukturen<br />
bzw. Vergesellschaftungsformen zugr<strong>und</strong>e liegen.« (8)<br />
Damus liefert eine nach den Kunstarten Malerei, Plastik <strong>und</strong> Architektur gegliederte<br />
wirkungsorientierte Materialanalyse. Er geht davon aus, daß die abstrakte, modeme<br />
Malerei weder in die Kunstvorstellungen des 'Stalinismus' noch in die des Faschismus<br />
übernommen werden konnte, da sie von der Masse nicht verstanden wurde, sie als Massenkunst<br />
unbrauchbar war. Im Gegenteil, durch die Negation der Modeme v.urde, aufgr<strong>und</strong><br />
der Aversion gegen diese Kunst, Massenloyalität mithergestellt. Deshalb knüpfen<br />
beide Gesellschaftsformen an die Tradition des »Illusionismus in der Kunst, der die Darstellung<br />
eines Ideals als Realität ermöglicht« (35), an. »Die Erhebung der Allgemeinverständlichkeit<br />
zur Norm« dient »der systemstabilisierenden, gesellschaftlichen Integration«<br />
(12). Die »direkte Indienststellung« der Malerei befriedigt die Bedürfnisse der<br />
Masse nach einer heilen, konfliktfreien Welt (11). Zu diesen Gemeinsamkeiten kommt<br />
Damus bei der Untersuchung von Führer-, Arbeiter- <strong>und</strong> Bauernbildern. Den Unterschieden,<br />
die er hier <strong>für</strong> den Faschismus bzw. den 'Stalinismus' feststellt (beispielsweise<br />
wird Hitler immer nur allein dargestellt, Stalin befindet sich fast immer unter<br />
Menschen), geht er leider nicht weiter nach, tut sie vielmehr mit der »unterschiedlichen<br />
Legitimation beider Systeme« (43) ab.<br />
»Die Plastik hat sich nicht in demselben Maße verselbständigt wie die Malerei <strong>und</strong> ist<br />
daher auch nicht so unverständlich geworden« (15). Sie dient traditionell der öffentlichen<br />
Repräsentation <strong>und</strong> der Darstellung des Staates. Ihre unmittelbare Körperlichkeit<br />
fördert die sinnliche Erlebbarkeit <strong>und</strong> Identifikation durch den Betrachter (16). In beiden<br />
Gesellschaftsformen wird die Identität mit Unterordnung verknüpft, die durch die<br />
»absolute Größe« (20) hergestellt wird. Die »repressive Monumentalität« (60), »die<br />
übermenschliche Größe« (64) soll den Betrachter »erschlagen, klein <strong>und</strong> demütig« (20)<br />
machen. Auch hier werden Unterschiede zwischen Faschismus <strong>und</strong> Realem Sozialismus<br />
nur konstatiert <strong>und</strong> nicht weiterverfolgt: So ist ein wichtiges Element der Plastik des Faschismus<br />
die Nacktheit der Figuren; sie wirkt enthistorisierend <strong>und</strong> klassenlos. Demgegenüber<br />
sind die Skulpturen des Realen Sozialismus durch ihre Bekleidung historisch<br />
<strong>und</strong> klassenmäßig charakterisiert. Im Vergleich zwischen dem sowjetischen Pavillon auf<br />
der Pariser Weltausstellung 1937, der den Sockel <strong>für</strong> eine dynamische, monumentale<br />
Plastik bildet, <strong>und</strong> dem gegenüber stehenden Deutschen Haus, dem die Plastik untergeordnet<br />
zu Füßen steht (66/67), werden ebenfalls die Unterschiede nicht beachtet.<br />
»Architektur <strong>und</strong> Stadtplanung schaffen <strong>und</strong> gestalten Außen- <strong>und</strong> Innemäume, sie<br />
formen Bereiche der Lebensumwelt des Menschen.« (16) Ihre Form wird von beiden<br />
Staaten sehr »bewußt geschaffen <strong>und</strong> eingesetzt« (80), ihre »Wirkung einkalkuliert«<br />
(105). »Gemeinsam ist beiden Systemen auch die Tendenz zur vereinheitlichenden Monumentalarchitektur.<br />
Beide beerben, wenn auch in unterschiedlichen Ausformungen,<br />
klassizistische Bauformen.« (21) Auch hier hat die Monumentalität wieder ein- <strong>und</strong> unterordnende<br />
Wirkung auf den Betrachter, dem mittels der klassizistischen Bauweise die<br />
Wiederherstellung der natürlichen Ordnung (81), die zeitlose Würde (76) <strong>und</strong> Festschreibung<br />
des Bestehenden sinnlich erfahrbar <strong>und</strong> erlebbar gemacht werden soll. Die Untersuchung<br />
zur Architektur benennt viele interessante Elemente, die die Wirkung der Gebäude<br />
ausmachen. So ist die Neue Reichskanzlei in Berlin, 1938/39 von A. Speer ge-