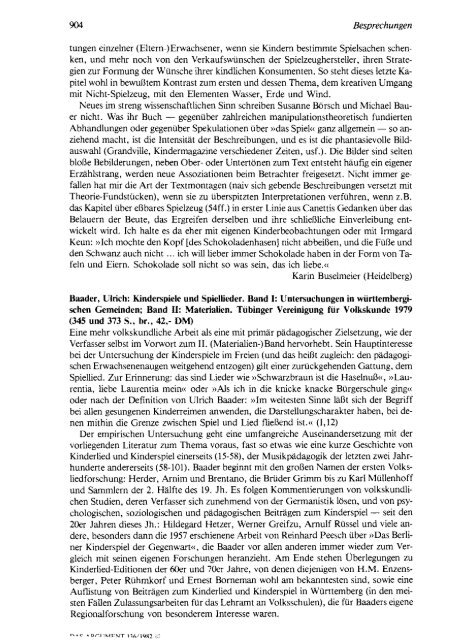Arbeitsteilung und Ideologie - Berliner Institut für kritische Theorie eV
Arbeitsteilung und Ideologie - Berliner Institut für kritische Theorie eV
Arbeitsteilung und Ideologie - Berliner Institut für kritische Theorie eV
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
904 Besprechungen<br />
tungen einzelner (Eltern-)Erwachsener, wenn sie Kindern bestimmte Spielsachen schenken,<br />
<strong>und</strong> mehr noch von den Verkaufswünschen der Spielzeughersteller , ihren Strategien<br />
zur Formung der Wünsche ihrer kindlichen Konsumenten. So steht dieses letzte Kapitel<br />
wohl in bewußtem Kontrast zum ersten <strong>und</strong> dessen Thema, dem kreativen Umgang<br />
mit Nicht-Spielzeug, mit den Elementen Wasser, Erde <strong>und</strong> Wind.<br />
Neues im streng wissenschaftlichen Sinn schreiben Susanne Börsch <strong>und</strong> Michael Bauer<br />
nicht. Was ihr Buch - gegenüber zahlreichen manipulationstheoretisch f<strong>und</strong>ierten<br />
Abhandlungen oder gegenüber Spekulationen über »das Spiel« ganz allgemein - so anziehend<br />
macht, ist die Intensität der Beschreibungen, <strong>und</strong> es ist die phantasievolle Bildauswahl<br />
(Grandville, Kindermagazine verschiedener Zeiten, usf.). Die Bilder sind selten<br />
bloße Bebilderungen, neben Ober- oder Untertönen zum Text entsteht häufig ein eigener<br />
Erzählstrang, werden neue Assoziationen beim Betrachter freigesetzt. Nicht immer gefallen<br />
hat mir die Art der Textmontagen (naiv sich gebende Beschreibungen versetzt mit<br />
<strong>Theorie</strong>-F<strong>und</strong>stücken), wenn sie zu überspitzten Interpretationen verführen, wenn z.B.<br />
das Kapitel über eßbares Spielzeug (54ff.) in erster Linie aus Canettis Gedanken über das<br />
Belauern der Beute, das Ergreifen derselben <strong>und</strong> ihre schließliche Einverleibung entwickelt<br />
wird. Ich halte es da eher mit eigenen Kinderbeobachtungen oder mit Irmgard<br />
Keun: »Ich mochte den Kopf [des Schokoladenhasen] nicht abbeißen, <strong>und</strong> die Füße <strong>und</strong><br />
den Schwanz auch nicht ... ich will lieber immer Schokolade haben in der Form von Tafeln<br />
<strong>und</strong> Eiern. Schokolade soll nicht so was sein, das ich liebe.«<br />
Karin Buselmeier (Heidelberg)<br />
Baader, Ulrich: Kinderspiele <strong>und</strong> Spiellieder. Band I: Untersuchungen in württembergisehen<br />
Gemeinden; Band 11: Materialien. Tübinger Vereinigung <strong>für</strong> Volksk<strong>und</strong>e 1979<br />
(345 <strong>und</strong> 373 S., br., 42,- DM)<br />
Eine mehr volksk<strong>und</strong>liche Arbeit als eine mit primär pädagogischer Zielsetzung, wie der<br />
Verfasser selbst im Vorwort zum II. (Materialien-)Band hervorhebt. Sein Hauptinteresse<br />
bei der Untersuchung der Kinderspiele im Freien (<strong>und</strong> das heißt zugleich: den pädagogischen<br />
Erwachsenenaugen weitgehend entzogen) gilt einer zurückgehenden Gattung, dem<br />
Spiellied. Zur Erinnerung: das sind Lieder wie »Schwarzbraun ist die Haselnuß«, »Laurentia,<br />
liebe Laurentia mein« oder »Als ich in die knicke knacke Bürgerschule ging«<br />
oder nach der Definition von Ulrich Baader: »Im weitesten Sinne läßt sich der Begriff<br />
bei allen gesungenen Kinderreimen anwenden, die Darstellungscharakter haben, bei denen<br />
mithin die Grenze zwischen Spiel <strong>und</strong> Lied fließend ist.« (1,12)<br />
Der empirischen Untersuchung geht eine umfangreiche Auseinandersetzung mit der<br />
vorliegenden Literatur zum Thema voraus, fast so etwas wie eine kurze Geschichte von<br />
Kinderlied <strong>und</strong> Kinderspiel einerseits (15-58), der Musikpädagogik der letzten zwei Jahrh<strong>und</strong>erte<br />
andererseits (58-101). Baader beginnt mit den großen Namen der ersten Volksliedforschung:<br />
Herder, Arnim <strong>und</strong> Brentano, die Brüder Grimm bis zu Karl Müllenhoff<br />
<strong>und</strong> Sammlern der 2. Hälfte des 19. Jh. Es folgen Kommentierungen von volksk<strong>und</strong>lichen<br />
Studien, deren Verfasser sich zunehmend von der Germanistik lösen, <strong>und</strong> von psychologischen,<br />
soziologischen <strong>und</strong> pädagogischen Beiträgen zum Kinderspiel - seit den<br />
20er Jahren dieses Jh.: Hildegard Hetzer, Werner Greifzu, Arnulf Rüssel <strong>und</strong> viele andere,<br />
besonders dann die 1957 erschienene Arbeit von Reinhard Peesch über »Das <strong>Berliner</strong><br />
Kinderspiel der Gegenwart«, die Baader vor allen anderen immer wieder zum Vergleich<br />
mit seinen eigenen Forschungen heranzieht. Am Ende stehen Überlegungen zu<br />
Kinderlied-Editionen der 60er <strong>und</strong> 70er Jahre, von denen diejenigen von H.M. Enzensberger,<br />
Peter Rührnkorf <strong>und</strong> Emest Borneman wohl am bekanntesten sind, sowie eine<br />
Auflistung von Beiträgen zum Kinderlied <strong>und</strong> Kinderspiel in Württemberg (in den meisten<br />
Fällen Zulassungsarbeiten <strong>für</strong> das Lehramt an Volksschulen), die <strong>für</strong> Baaders eigene<br />
Regionalforschung von besonderem Interesse waren .<br />
..... AC' Aor.111l.,iJ:;NT l1f"/!QR2