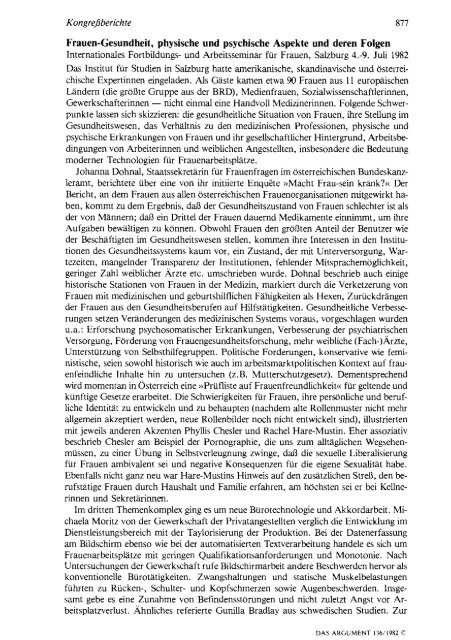Arbeitsteilung und Ideologie - Berliner Institut für kritische Theorie eV
Arbeitsteilung und Ideologie - Berliner Institut für kritische Theorie eV
Arbeitsteilung und Ideologie - Berliner Institut für kritische Theorie eV
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Kongreßberichte 877<br />
Frauen-Ges<strong>und</strong>heit, physische <strong>und</strong> psychische Aspekte <strong>und</strong> deren Folgen<br />
Internationales Fortbildungs- <strong>und</strong> Arbeitsseminar <strong>für</strong> Frauen, Salzburg 4.-9. Juli 1982<br />
Das <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> Studien in Salzburg hatte amerikanische, skandinavische <strong>und</strong> österreichische<br />
Expertinnen eingeladen. Als Gäste kamen etwa 90 Frauen aus 11 europäischen<br />
Ländern (die größte Gruppe aus der BRD), Medienfrauen, Sozialwissenschaftlerinnen,<br />
Gewerkschafterinnen - nicht einmal eine Handvoll Medizinerinnen. Folgende Schwerpunkte<br />
lassen sich skizzieren: die ges<strong>und</strong>heitliche Situation von Frauen, ihre Stellung im<br />
Ges<strong>und</strong>heitswesen, das Verhältnis zu den medizinischen Professionen, physische <strong>und</strong><br />
psychische Erkrankungen von Frauen <strong>und</strong> ihr gesellschaftlicher Hintergr<strong>und</strong>, Arbeitsbedingungen<br />
von Arbeiterinnen <strong>und</strong> weiblichen Angestellten, insbesondere die Bedeutung<br />
moderner Technologien <strong>für</strong> Frauenarbeitsplätze.<br />
Johanna Dohnal, Staatssekretärin <strong>für</strong> Frauenfragen im österreichischen B<strong>und</strong>eskanzleramt,<br />
berichtete über eine von ihr initiierte Enquete »Macht Frau-sein krank?« Der<br />
Bericht, an dem Frauen aus allen österreichischen Frauenorganisationen mitgewirkt haben,<br />
kommt zu dem Ergebnis, daß der Ges<strong>und</strong>heitszustand von Frauen schlechter ist als<br />
der von Männern; daß ein Drittel der Frauen dauernd Medikamente einnimmt, um ihre<br />
Aufgaben bewältigen zu können. Obwohl Frauen den größten Anteil der Benutzer wie<br />
der Beschäftigten im Ges<strong>und</strong>heitswesen stellen, kommen ihre Interessen in den <strong>Institut</strong>ionen<br />
des Ges<strong>und</strong>heitssystems kaum vor, ein Zustand, der mit Unterversorgung, Wartezeiten,<br />
mangelnder Transparenz der <strong>Institut</strong>ionen, fehlender Mitsprachemöglichkeit,<br />
geringer Zahl weiblicher Ärzte etc. umschrieben wurde. Dohnal beschrieb auch einige<br />
historische Stationen von Frauen in der Medizin, markiert durch die Verketzerung von<br />
Frauen mit medizinischen <strong>und</strong> geburtshilflichen Fähigkeiten als Hexen, Zurückdrängen<br />
der Frauen aus den Ges<strong>und</strong>heitsberufen auf Hilfstätigkeiten. Ges<strong>und</strong>heitliche Verbesserungen<br />
setzen Veränderungen des medizinischen Systems voraus, vorgeschlagen wurden<br />
u.a.: Erforschung psychosomatischer Erkrankungen, Verbesserung der psychiatrischen<br />
Versorgung, Förderung von Frauenges<strong>und</strong>heitsforschung, mehr weibliche (Fach-)Ärzte,<br />
Unterstützung von Selbsthilfegruppen. Politische Forderungen, konservative wie feministische,<br />
seien sowohl historisch wie auch im arbeitsmarktpolitischen Kontext auf frauenfeindliche<br />
Inhalte hin zu untersuchen (z.B. Mutterschutzgesetz). Dementsprechend<br />
wird momentan in Österreich eine »Prüfliste auf Frauenfre<strong>und</strong>lichkeit« <strong>für</strong> geltende <strong>und</strong><br />
künftige Gesetze erarbeitet. Die Schwierigkeiten <strong>für</strong> Frauen, ihre persönliche <strong>und</strong> berufliche<br />
Identität zu entwickeln <strong>und</strong> zu behaupten (nachdem alte Rollenmuster nicht mehr<br />
allgemein akzeptiert werden, neue Rollenbilder noch nicht entwickelt sind), illustrierten<br />
mit jeweils anderen Akzenten Phyllis Chesler <strong>und</strong> Rachel Hare-Mustin. Eher assoziativ<br />
beschrieb Chesler am Beispiel der Pornographie, die uns zum alltäglichen Wegsehenmüssen,<br />
zu einer Übung in Selbstverleugnung zwinge, daß die sexuelle Liberalisierung<br />
<strong>für</strong> Frauen ambivalent sei <strong>und</strong> negative Konsequenzen <strong>für</strong> die eigene Sexualität habe.<br />
Ebenfalls nicht ganz neu war Hare-Mustins Hinweis auf den zusätzlichen Streß, den berufstätige<br />
Frauen durch Haushalt <strong>und</strong> Familie erfahren, am höchsten sei er bei Kellnerinnen<br />
<strong>und</strong> Sekretärinnen.<br />
Im dritten Themenkomplex ging es um neue Bürotechnologie <strong>und</strong> Akkordarbeit. Michaela<br />
Moritz von der Gewerkschaft der Privatangestellten verglich die Entwicklung im<br />
Dienstleistungsbereich mit der Taylorisierung der Produktion. Bei der Datenerfassung<br />
am Bildschirm ebenso wie bei der automatisierten Textverarbeitung handele es sich um<br />
Frauenarbeitsplätze mit geringen Qualifikationsanforderungen <strong>und</strong> Monotonie. Nach<br />
Untersuchungen der Gewerkschaft rufe Bildschirmarbeit andere Beschwerden hervor als<br />
konventionelle Bürotätigkeiten. Zwangshaltungen <strong>und</strong> statische Muskelbelastungen<br />
führten zu Rücken-, Schulter- <strong>und</strong> Kopfschmerzen sowie Augenbeschwerden. Insgesamt<br />
gebe es eine Zunahme von Befindensstörungen <strong>und</strong> nicht zuletzt Angst vor Arbeitsplatzverlust.<br />
Ähnliches referierte Gunilla Bradlay aus schwedischen Studien. Zur<br />
DAS ARGUMENT 136/1982 es