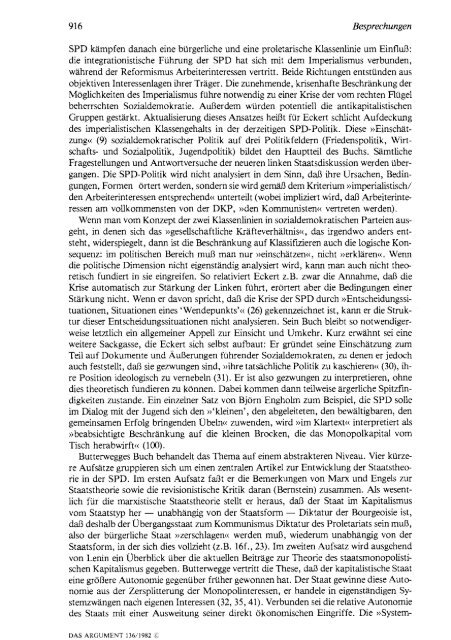Arbeitsteilung und Ideologie - Berliner Institut für kritische Theorie eV
Arbeitsteilung und Ideologie - Berliner Institut für kritische Theorie eV
Arbeitsteilung und Ideologie - Berliner Institut für kritische Theorie eV
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
DAS ARGUMENT 136/1982 :s<br />
916 Besprechungen<br />
SPD kämpfen danach eine bürgerliche <strong>und</strong> eine proletarische Klassenlinie um Einfluß:<br />
die integrationistische Führung der SPD hat sich mit dem Imperialismus verb<strong>und</strong>en,<br />
während der Reformismus Arbeiterinteressen vertritt. Beide Richtungen entstünden aus<br />
objektiven Interessenlagen ihrer Träger. Die zunehmende, krisenhafte Beschränkung der<br />
Möglichkeiten des Imperialismus führe notwendig zu einer Krise der vom rechten Flügel<br />
beherrschten Sozialdemokratie. Außerdem würden potentiell die antikapitalistischen<br />
Gruppen gestärkt. Aktualisierung dieses Ansatzes heißt <strong>für</strong> Eckert schlicht Aufdeckung<br />
des imperialistischen Klassengehalts in der derzeitigen SPD-Politik. Diese »Einschätzung«<br />
(9) sozialdemokratischer Politik auf drei Politikfeldern (Friedenspolitik, Wirtschafts-<br />
<strong>und</strong> Sozialpolitik, Jugendpolitik) bildet den Hauptteil des Buchs. Sämtliche<br />
Fragestellungen <strong>und</strong> Antwortversuche der neueren linken Staatsdiskussion werden übergangen.<br />
Die SPD-Politik wird nicht analysiert in dem Sinn, daß ihre Ursachen, Bedingungen,<br />
Formen örtert werden, sondern sie wird gemäß dem Kriterium »imperialistisch/<br />
den Arbeiterinteressen entsprechend« unterteilt (wobei impliziert wird, daß Arbeiterinteressen<br />
am vollkommensten von der DKP, »den Kommunisten« vertreten werden).<br />
Wenn man vom Konzept der zwei Klassenlinien in sozialdemokratischen Parteien ausgeht,<br />
in denen sich das »gesellschaftliche Kräfteverhältnis«, das irgendwo anders entsteht,<br />
widerspiegelt, dann ist die Beschränkung auf Klassifizieren auch die logische Konsequenz:<br />
im politischen Bereich muß man nur »einschätzen«, nicht »erklären«. Wenn<br />
die politische Dimension nicht eigenständig analysiert wird, kann man auch nicht theoretisch<br />
f<strong>und</strong>iert in sie eingreifen. So relativiert Eckert z.B. zwar die Annahme, daß die<br />
Krise automatisch zur Stärkung der Linken führt, erörtert aber die Bedingungen einer<br />
Stärkung nicht. Wenn er davon spricht, daß die Krise der SPD durch »Entscheidungssituationen,<br />
Situationen eines 'Wendepunkts'« (26) gekennzeichnet ist, kann er die Struktur<br />
dieser Entscheidungssituationen nicht analysieren. Sein Buch bleibt so notwendigerweise<br />
letztlich ein allgemeiner Appell zur Einsicht <strong>und</strong> Umkehr. Kurz erwähnt sei eine<br />
weitere Sackgasse, die Eckert sich selbst aufbaut: Er gründet seine Einschätzung zum<br />
Teil auf Dokumente <strong>und</strong> Äußerungen führender Sozialdemokraten, zu denen er jedoch<br />
auch feststellt, daß sie gezwungen sind, »ihre tatsächliche Politik zu kaschieren« (30), ihre<br />
Position ideologisch zu vernebeln (31). Er ist also gezwungen zu interpretieren, ohne<br />
dies theoretisch f<strong>und</strong>ieren zu können. Dabei kommen dann teilweise ärgerliche Spitzfmdigkeiten<br />
zustande. Ein einzelner Satz von Björn Engholm zum Beispiel, die SPD solle<br />
im Dialog mit der Jugend sich den »'kleinen', den abgeleiteten, den bewältigbaren, den<br />
gemeinsamen Erfolg bringenden Übeln« zuwenden, wird »im Klartext« interpretiert als<br />
»beabsichtigte Beschränkung auf die kleinen Brocken, die das Monopolkapital vom<br />
Tisch herab wirft« (100).<br />
Butterwegges Buch behandelt das Thema auf einem abstrakteren Niveau. Vier kürzere<br />
Aufsätze gruppieren sich um einen zentralen Artikel zur Entwicklung der Staatstheorie<br />
in der SPD. Im ersten Aufsatz faßt er die Bemerkungen von Marx <strong>und</strong> Engels zur<br />
Staatstheorie sowie die revisionistische Kritik daran (Bernstein) zusammen. Als wesentlich<br />
<strong>für</strong> die marxistische Staatstheorie stellt er heraus, daß der Staat im Kapitalismus<br />
vom Staatstyp her - unabhängig von der Staatsform - Diktatur der Bourgeoisie ist,<br />
daß deshalb der Übergangsstaat zum Kommunismus Diktatur des Proletariats sein muß,<br />
also der bürgerliche Staat »zerschlagen« werden muß, wiederum unabhängig von der<br />
Staatsform, in der sich dies vollzieht (z.B. 16f., 23). Im zweiten Aufsatz wird ausgehend<br />
von Lenin ein Überblick über die aktuellen Beiträge zur <strong>Theorie</strong> des staatsmonopolistischen<br />
Kapitalismus gegeben. Butterwegge vertritt die These, daß der kapitalistische Staat<br />
eine größere Autonomie gegenüber früher gewonnen hat. Der Staat gewinne diese Autonomie<br />
aus der Zersplitterung der Monopolinteressen, er handele in eigenständigen Systemzwängen<br />
nach eigenen Interessen (32,35,41). Verb<strong>und</strong>en sei die relative Autonomie<br />
des Staats mit einer Ausweitung seiner direkt ökonomischen Eingriffe. Die »System-