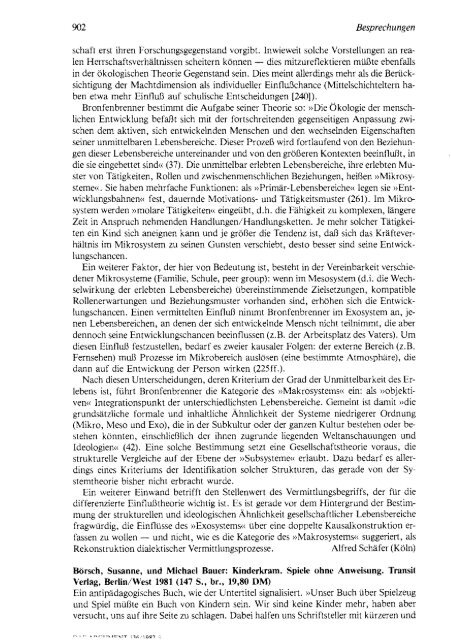Arbeitsteilung und Ideologie - Berliner Institut für kritische Theorie eV
Arbeitsteilung und Ideologie - Berliner Institut für kritische Theorie eV
Arbeitsteilung und Ideologie - Berliner Institut für kritische Theorie eV
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
902 Besprechungen<br />
schaft erst ihren Forschungsgegenstand vorgibt. Inwieweit solche Vorstellungen an realen<br />
Herrschaftsverhältnissen scheitern können - dies mitzureflektieren müßte ebenfalls<br />
in der ökologischen <strong>Theorie</strong> Gegenstand sein. Dies meint allerdings mehr als die Berücksichtigung<br />
der Machtdimension als individueller Einflußchance (Mittelschichteltern haben<br />
etwa mehr Einfluß auf schulische Entscheidungen [240]).<br />
Bronfenbrenner bestimmt die Aufgabe seiner <strong>Theorie</strong> so: »Die Ökologie der menschlichen<br />
Entwicklung befaßt sich mit der fortschreitenden gegenseitigen Anpassung zwischen<br />
dem aktiven, sich entwickelnden Menschen <strong>und</strong> den wechselnden Eigenschaften<br />
seiner unmittelbaren Lebensbereiche. Dieser Prozeß wird fortlaufend von den Beziehungen<br />
dieser Lebensbereiche untereinander <strong>und</strong> von den größeren Kontexten beeinflußt, in<br />
die sie eingebettet sind« (37). Die unmittelbar erlebten Lebensbereiche, ihre erlebten Muster<br />
von Tätigkeiten, Rollen <strong>und</strong> zwischenmenschlichen Beziehungen, heißen »Mikrosysteme«.<br />
Sie haben mehrfache Funktionen: als »Primär-Lebensbereiche« legen sie »Entwicklungsbahnen«<br />
fest, dauernde Motivations- <strong>und</strong> Tätigkeitsmuster (261). Im Mikrosystem<br />
werden »molare Tätigkeiten« eingeübt, d.h. die Fähigkeit zu komplexen, längere<br />
Zeit in Anspruch nehmenden Handlungen/Handlungsketten. Je mehr solcher Tätigkeiten<br />
ein Kind sich aneignen kann <strong>und</strong> je größer die Tendenz ist, daß sich das Kräfteverhältnis<br />
im Mikrosystem zu seinen Gunsten verschiebt, desto besser sind seine Entwicklungschancen.<br />
Ein weiterer Faktor, der hier von Bedeutung ist, besteht in der Vereinbarkeit verschiedener<br />
Mikrosysteme (Familie, Schule, peer group): wenn im Mesosystem (d.i. die Wechselwirkung<br />
der erlebten Lebensbereiche) übereinstimmende Zielsetzungen, kompatible<br />
Rollenerwartungen <strong>und</strong> Beziehungsmuster vorhanden sind, erhöhen sich die Entwicklungschancen.<br />
Einen vermittelten Einfluß ninunt Bronfenbrenner im Exosystem an, jenen<br />
Lebensbereichen, an denen der sich entwickelnde Mensch nicht teilnimmt, die aber<br />
dennoch seine Entwicklungschancen beeinflussen (z.B. der Arbeitsplatz des Vaters). Um<br />
diesen Einfluß festzustellen, bedarf es zweier kausaler Folgen: der externe Bereich (z.B.<br />
Fernsehen) muß Prozesse im Mikrobereich auslösen (eine bestimmte Atmosphäre), die<br />
dann auf die Entwickung der Person wirken (225ff.).<br />
Nach diesen Unterscheidungen, deren Kriterium der Grad der Unmittelbarkeit des Erlebens<br />
ist, führt Bronfenbrenner die Kategorie des »Makrosystems« ein: als »objektiven«<br />
Integrationspunkt der unterschiedlichsten Lebensbereiche. Gemeint ist damit »die<br />
gr<strong>und</strong>sätzliche formale <strong>und</strong> inhaltliche Ähnlichkeit der Systeme niedrigerer Ordnung<br />
(Mikro, Meso <strong>und</strong> Exo), die in der Subkultur oder der ganzen Kultur bestehen oder bestehen<br />
könnten, einschließlich der ihnen zugr<strong>und</strong>e liegenden Weltanschauungen <strong>und</strong><br />
<strong>Ideologie</strong>n« (42). Eine solche Bestimmung setzt eine Gesellschaftstheorie voraus, die<br />
strukturelle Vergleiche auf der Ebene der »Subsysteme« erlaubt. Dazu bedarf es allerdings<br />
eines Kriteriums der Identifikation solcher Strukturen, das gerade von der Systemtheorie<br />
bisher nicht erbracht wurde.<br />
Ein weiterer Einwand betrifft den Stellenwert des Vermittlungsbegriffs, der <strong>für</strong> die<br />
differenzierte Eint1ußtheorie wichtig ist. Es ist gerade vor dem Hintergr<strong>und</strong> der Bestimmung<br />
der strukturellen <strong>und</strong> ideologischen Ähnlichkeit gesellschaftlicher Lebensbereiche<br />
frag\Vürdig, die Einflüsse des »Exosystems« über eine doppelte Kausalkonstruktion erfassen<br />
zu wollen - <strong>und</strong> nicht, wie es die Kategorie des »Makrosystems« suggeriert, als<br />
Rekonstruktion dialektischer Vermittlungsprozesse.<br />
Alfred Schäfer (Köln)<br />
Börsch, Susanne, <strong>und</strong> Michael Bauer: Kinderkram. Spiele ohne Anweisung. Transit<br />
Verlag, Berlin/West 1981 (147 S., br., 19,80 DM)<br />
Ein antipädagogisches Buch, wie der Untertitel signalisiert. »Unser Buch über Spielzeug<br />
<strong>und</strong> Spiel müßte ein Buch von Kindern sein. Wir sind keine Kinder mehr, haben aber<br />
versucht, uns auf ihre Seite zu schlagen. Dabei halfen uns Schriftsteller mit kürzeren <strong>und</strong>