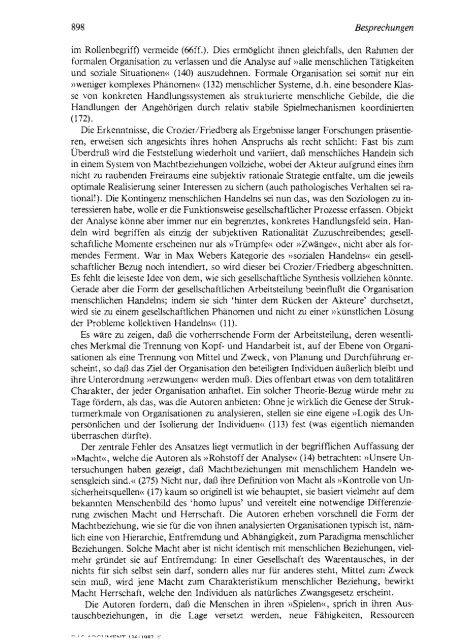Arbeitsteilung und Ideologie - Berliner Institut für kritische Theorie eV
Arbeitsteilung und Ideologie - Berliner Institut für kritische Theorie eV
Arbeitsteilung und Ideologie - Berliner Institut für kritische Theorie eV
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
898 Besprechungen<br />
im Rollenbegriff) vermeide (66ff.). Dies ermöglicht ihnen gleichfalls, den Rahmen der<br />
formalen Organisation zu verlassen <strong>und</strong> die Analyse auf »alle menschlichen Tätigkeiten<br />
<strong>und</strong> soziale Situationen« (140) auszudehnen. Formale Organisation sei somit nur ein<br />
»weniger komplexes Phänomen« (132) menschlicher Systeme, d.h. eine besondere Klasse<br />
von konkreten Handlungssystemen als strukturierte menschliche Gebilde, die die<br />
Handlungen der Angehörigen durch relativ stabile Spielmechanismen koordinierten<br />
(172).<br />
Die Erkenntnisse, die Crozier/Friedberg als Ergebnisse langer Forschungen präsentieren,<br />
erweisen sich angesichts ihres hohen Anspruchs als recht schlicht: Fast bis zum<br />
Überdruß wird die Feststellung wiederholt <strong>und</strong> variiert, daß menschliches Handeln sich<br />
in einem System von Machtbeziehungen vollziehe, wobei der Akteur aufgr<strong>und</strong> eines ihm<br />
nicht zu raubenden Freiraums eine subjektiv rationale Strategie entfalte, um die jeweils<br />
optimale Realisierung seiner Interessen zu sichern (auch pathologisches Verhalten sei rational!).<br />
Die Kontingenz menschlichen Handelns sei nun das, was den Soziologen zu interessieren<br />
habe, wolle er die Funktionsweise gesellschaftlicher Prozesse erfassen. Objekt<br />
der Analyse könne aber immer nur ein begrenztes, konkretes Handlungsfeld sein. Handeln<br />
wird begriffen als einzig der subjektiven Rationalität Zuzuschreibendes; gesellschaftliche<br />
Momente erscheinen nur als »Trümpfe« oder »Zwänge«, nicht aber als formendes<br />
Ferment. War in Max Webers Kategorie des »sozialen Handeins« ein gesellschaftlicher<br />
Bezug noch intendiert, so wird dieser bei Crozier/Friedberg abgeschnitten.<br />
Es fehlt die leiseste Idee von dem, wie sich gesellschaftliche Synthesis vollziehen könnte.<br />
Gerade aber die Form der gesellschaftlichen <strong>Arbeitsteilung</strong> beeinflußt die Organisation<br />
menschlichen Handeins; indem sie sich 'hinter dem Rücken der Akteure' durchsetzt,<br />
wird sie zu einem gesellschaftlichen Phänomen <strong>und</strong> nicht zu einer »künstlichen Lösung<br />
der Probleme kollektiven Handeins« (11).<br />
Es wäre zu zeigen, daß die vorherrschende Form der <strong>Arbeitsteilung</strong>, deren wesentliches<br />
Merkmal die Trennung von Kopf- <strong>und</strong> Handarbeit ist, auf der Ebene von Organisationen<br />
als eine Trennung von Mittel <strong>und</strong> Zweck, von Planung <strong>und</strong> Durchführung erscheint,<br />
so daß das Ziel der Organisation den beteiligten Indi\iduen äußerlich bleibt <strong>und</strong><br />
ihre Unterordnung »erzwungen« werden muß. Dies offenbart etwas von dem totalitären<br />
Charakter, der jeder Organisation anhaftet. Ein solcher <strong>Theorie</strong>-Bezug würde mehr zu<br />
Tage fördern, als das, was die Autoren anbieten: Ohne je wirklich die Genese der Strukturmerkmale<br />
von Organisationen zu analysieren, stellen sie eine eigene »Logik des Unpersönlichen<br />
<strong>und</strong> der Isolierung der Individuen« (113) fest (was eigentlich niemanden<br />
überraschen dürfte).<br />
Der zentrale Fehler des Ansatzes liegt vermutlich in der begrifflichen Auffassung der<br />
»Macht«, welche die Autoren als »Rohstoff der Analyse« (14) betrachten: »Unsere Untersuchungen<br />
haben gezeigt, daß Machtbeziehungen mit menschlichem Handeln wesensgleich<br />
sind.« (275) Nicht nur, daß ihre Definition von Macht als »Kontrolle von Unsicherheitsquellen«<br />
(17) kaum so originell ist wie behauptet, sie basiert vielmehr auf dem<br />
bekannten Menschenbild des 'homo lupus' <strong>und</strong> vereitelt eine notwendige Differenzierung<br />
zwischen Macht <strong>und</strong> Herrschaft. Die Autoren erheben vorschnell die Form der<br />
Machtbeziehung, wie sie <strong>für</strong> die von ihnen analysierten Organisationen typisch ist, nämlich<br />
eine von Hierarchie, Entfremdung <strong>und</strong> Abhängigkeit, zum Paradigma menschlicher<br />
Beziehungen. Solche Macht aber ist nicht identisch mit menschlichen Beziehungen, vielmehr<br />
gründet sie auf Entfremdung: In einer Gesellschaft des Warentausches, in der<br />
nichts <strong>für</strong> sich selbst sein darf, sondern alles nur <strong>für</strong> anderes steht, Mittel zum Zweck<br />
sein muß, wird jene Macht zum Charakteristikum menschlicher Beziehung, bewirkt<br />
Macht Herrschaft, welche den Individuen als natürliches Zwangsgesetz erscheint.<br />
Die Autoren fordern, daß die Menschen in ihren »Spielen«, sprich in ihren Austausch<br />
beziehungen, in die Lage versetzt werden, neue Fähigkeiten, Ressourcen