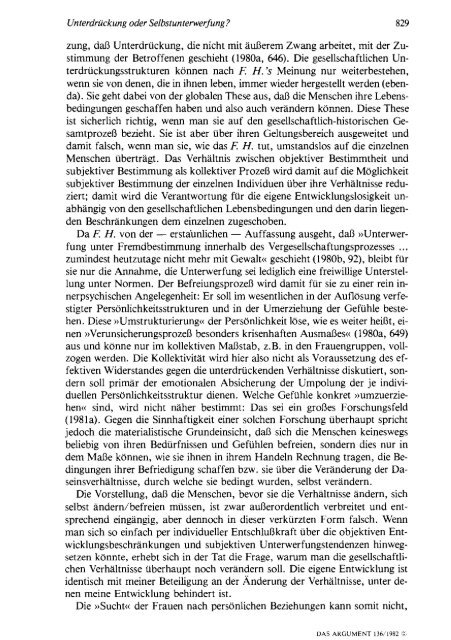Arbeitsteilung und Ideologie - Berliner Institut für kritische Theorie eV
Arbeitsteilung und Ideologie - Berliner Institut für kritische Theorie eV
Arbeitsteilung und Ideologie - Berliner Institut für kritische Theorie eV
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Unterdrückung oder Selbstunterwerfung ? 829<br />
zung, daß Unterdrückung, die nicht mit äußerem Zwang arbeitet, mit der Zustimmung<br />
der Betroffenen geschieht (1980a, 646). Die gesellschaftlichen Unterdrückungsstrukturen<br />
können nach F. H. 's Meinung nur weiterbestehen,<br />
wenn sie von denen, die in ihnen leben, immer wieder hergestellt werden (ebenda).<br />
Sie geht dabei von der globalen These aus, daß die Menschen ihre Lebensbedingungen<br />
geschaffen haben <strong>und</strong> also auch verändern können. Diese These<br />
ist sicherlich richtig, wenn man sie auf den gesellschaftlich-historischen Gesamtprozeß<br />
bezieht. Sie ist aber über ihren Geltungsbereich ausgeweitet <strong>und</strong><br />
damit falsch, wenn man sie, wie das F. H. tut, umstandslos auf die einzelnen<br />
Menschen überträgt. Das Verhältnis zwischen objektiver Bestimmtheit <strong>und</strong><br />
subjektiver Bestimmung als kollektiver Prozeß wird damit auf die Möglichkeit<br />
subjektiver Bestimmung der einzelnen Individuen über ihre Verhältnisse reduziert;<br />
damit wird die Verantwortung <strong>für</strong> die eigene Entwicklungslosigkeit unabhängig<br />
von den gesellschaftlichen Lebensbedingungen <strong>und</strong> den darin liegenden<br />
Beschränkungen dem einzelnen zugeschoben.<br />
Da F. H. von der - erstahnlichen - Auffassung ausgeht, daß »Unterwerfung<br />
unter Fremdbestimmung innerhalb des Vergesellschaftungsprozesses ...<br />
zumindest heutzutage nicht mehr mit Gewalt« geschieht (1 980b, 92), bleibt <strong>für</strong><br />
sie nur die Annahme, die Unterwerfung sei lediglich eine freiwillige Unterstellung<br />
unter Normen. Der Befreiungsprozeß wird damit <strong>für</strong> sie zu einer rein innerpsychischen<br />
Angelegenheit: Er soll im wesentlichen in der Auflösung verfestigter<br />
Persönlichkeitsstrukturen <strong>und</strong> in der Umerziehung der Gefühle bestehen.<br />
Diese »Umstrukturierung« der Persönlichkeit löse, wie es weiter heißt, einen<br />
»Verunsicherungsprozeß besonders krisenhaften Ausmaßes« (1980a, 649)<br />
aus <strong>und</strong> könne nur im kollektiven Maßstab, z.B. in den Frauengruppen, vollzogen<br />
werden. Die Kollektivität wird hier also nicht als Voraussetzung des effektiven<br />
Widerstandes gegen die unterdrückenden Verhältnisse diskutiert, sondern<br />
soll primär der emotionalen Absicherung der Umpolung der je individuellen<br />
Persönlichkeitsstruktur dienen. Welche Gefühle konkret >>Umzuerziehen«<br />
sind, wird nicht näher bestimmt: Das sei ein großes Forschungsfeld<br />
(1981a). Gegen die Sinnhaftigkeit einer solchen Forschung überhaupt spricht<br />
jedoch die materialistische Gr<strong>und</strong>einsicht, daß sich die Menschen keineswegs<br />
beliebig von ihren Bedürfnissen <strong>und</strong> Gefühlen befreien, sondern dies nur in<br />
dem Maße können, wie sie ihnen in ihrem Handeln Rechnung tragen, die Bedingungen<br />
ihrer Befriedigung schaffen bzw. sie über die Veränderung der Daseinsverhältnisse,<br />
durch welche sie bedingt wurden, selbst verändern.<br />
Die Vorstellung, daß die Menschen, bevor sie die Verhältnisse ändern, sich<br />
selbst ändern/befreien müssen, ist zwar außerordentlich verbreitet <strong>und</strong> entsprechend<br />
eingängig, aber dennoch in dieser verkürzten Form falsch. Wenn<br />
man sich so einfach per individueller Entschlußkraft über die objektiven Entwicklungs<br />
beschränkungen <strong>und</strong> subjektiven Unterwerfungstendenzen hinwegsetzen<br />
könnte, erhebt sich in der Tat die Frage, warum man die gesellschaftlichen<br />
Verhältnisse überhaupt noch verändern soll. Die eigene Entwicklung ist<br />
identisch mit meiner Beteiligung an der Änderung der Verhältnisse, unter denen<br />
meine Entwicklung behindert ist.<br />
Die »Sucht« der Frauen nach persönlichen Beziehungen kann somit nicht,<br />
DAS ARGUMENT 136/1982