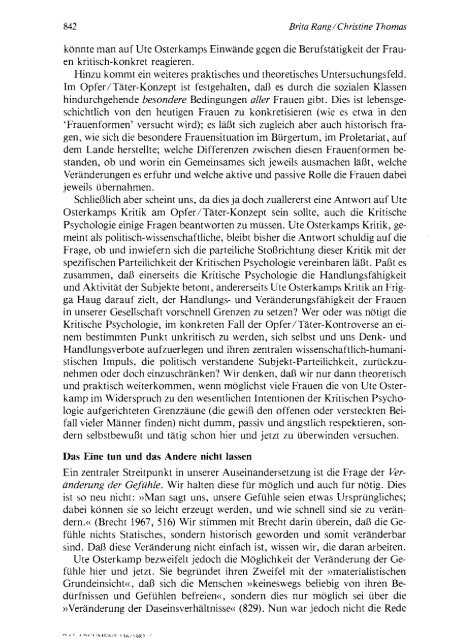Arbeitsteilung und Ideologie - Berliner Institut für kritische Theorie eV
Arbeitsteilung und Ideologie - Berliner Institut für kritische Theorie eV
Arbeitsteilung und Ideologie - Berliner Institut für kritische Theorie eV
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
842 Brita Rang/Christine Thomas<br />
könnte man auf Ute Osterkamps Einwände gegen die Berufstätigkeit der Frauen<br />
kritisch-konkret reagieren.<br />
Hinzu kommt ein weiteres praktisches <strong>und</strong> theoretisches Untersuchungsfeld.<br />
Im Opfer/Täter-Konzept ist festgehalten, daß es durch die sozialen Klassen<br />
hindurchgehende besondere Bedingungen aller Frauen gibt. Dies ist lebensgeschichtlich<br />
von den heutigen Frauen zu konkretisieren (wie es etwa in den<br />
'Frauenformen' versucht wird); es läßt sich zugleich aber auch historisch fragen,<br />
wie sich die besondere Frauensituation im Bürgertum, im Proletariat, auf<br />
dem Lande herstellte; welche Differenzen zwischen diesen Frauenformen bestanden,<br />
ob <strong>und</strong> worin ein Gemeinsames sich jeweils ausmachen läßt, welche<br />
Veränderungen es erfuhr <strong>und</strong> welche aktive <strong>und</strong> passive Rolle die Frauen dabei<br />
jeweils übernahmen.<br />
Schließlich aber scheint uns, da dies ja doch zuallererst eine Antwort auf Ute<br />
Osterkamps Kritik am Opfer/Täter-Konzept sein sollte, auch die Kritische<br />
Psychologie einige Fragen beantworten zu müssen. Ute Osterkamps Kritik, gemeint<br />
als politisch-wissenschaftliche, bleibt bisher die Antwort schuldig auf die<br />
Frage, ob <strong>und</strong> inwiefern sich die parteiliche Stoßrichtung dieser Kritik mit der<br />
spezifischen Parteilichkeit der Kritischen Psychologie vereinbaren läßt. Paßt es<br />
zusammen, daß einerseits die Kritische Psychologie die Handlungsfähigkeit<br />
<strong>und</strong> Aktivität der Subjekte betont, andererseits Ute Osterkamps Kritik an Frigga<br />
Haug darauf zielt, der Handlungs- <strong>und</strong> Veränderungs fähigkeit der Frauen<br />
in unserer Gesellschaft vorschnell Grenzen zu setzen? Wer oder was nötigt die<br />
Kritische Psychologie, im konkreten Fall der Opfer /Täter-Kontroverse an einem<br />
bestimmten Punkt unkritisch zu werden, sich selbst <strong>und</strong> uns Denk- <strong>und</strong><br />
Handlungsverbote aufzuerlegen <strong>und</strong> ihren zentralen wissenschaftlich-humanistischen<br />
Impuls, die politisch verstandene Subjekt-Parteilichkeit, zurückzunehmen<br />
oder doch einzuschränken? Wir denken, daß wir nur dann theoretisch<br />
<strong>und</strong> praktisch weiterkommen, wenn möglichst viele Frauen die von Ute Osterkamp<br />
im Widerspruch zu den wesentlichen Intentionen der Kritischen Psychologie<br />
aufgerichteten Grenzzäune (die gewiß den offenen oder versteckten Beifall<br />
vieler Männer finden) nicht dumm, passiv <strong>und</strong> ängstlich respektieren, sondern<br />
selbstbewußt <strong>und</strong> tätig schon hier <strong>und</strong> jetzt zu überwinden versuchen.<br />
Das Eine tun <strong>und</strong> das Andere nicht lassen<br />
Ein zentraler Streitpunkt in unserer Auseinandersetzung ist die Frage der Veränderung<br />
der Gefühle. Wir halten diese <strong>für</strong> möglich <strong>und</strong> auch <strong>für</strong> nötig. Dies<br />
ist so neu nicht: »Man sagt uns, unsere Gefühle seien etwas Ursprüngliches;<br />
dabei können sie so leicht erzeugt werden, <strong>und</strong> wie schnell sind sie zu verändern.«<br />
(Brecht 1967, 516) Wir stimmen mit Brecht darin überein, daß die Gefühle<br />
nichts Statisches, sondern historisch geworden <strong>und</strong> somit veränderbar<br />
sind. Daß diese Veränderung nicht einfach ist, wissen wir, die daran arbeiten.<br />
Ute Osterkamp bezweifelt jedoch die Möglichkeit der Veränderung der Gefühle<br />
hier <strong>und</strong> jetzt. Sie begründet ihren Zweifel mit der »materialistischen<br />
Gr<strong>und</strong>einsicht« , daß sich die Menschen » keineswegs beliebig von ihren Bedürfnissen<br />
<strong>und</strong> Gefühlen befreien«, sondern dies nur möglich sei über die<br />
»Veränderung der Daseinsverhältnisse« (829). Nun war jedoch nicht die Rede