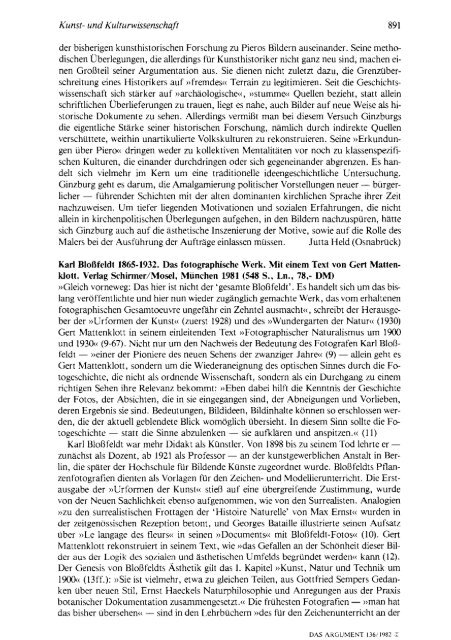Arbeitsteilung und Ideologie - Berliner Institut für kritische Theorie eV
Arbeitsteilung und Ideologie - Berliner Institut für kritische Theorie eV
Arbeitsteilung und Ideologie - Berliner Institut für kritische Theorie eV
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Kunst- <strong>und</strong> Ku{turwissenscha!t 891<br />
der bisherigen kunsthistorischen Forschung zu Pieros Bildern auseinander. Seine methodischen<br />
Überlegungen, die allerdings <strong>für</strong> Kunsthistoriker nicht ganz neu sind, machen einen<br />
Großteil seiner Argumentation aus. Sie dienen nicht zuletzt dazu, die GrellZÜberschreitung<br />
eines Historikers auf »fremdes« Terrain zu legitimieren. Seit die Geschichtswissenschaft<br />
sich stärker auf »archäologische«, »stumme« Quellen bezieht, statt allein<br />
schriftlichen Überlieferungen zu trauen, liegt es nahe, auch Bilder auf neue Weise als historische<br />
Dokumente zu sehen. Allerdings vermißt man bei diesem Versuch Ginzburgs<br />
die eigentliche Stärke seiner historischen Forschung, nämlich durch indirekte Quellen<br />
verschüttete, weithin unartikulierte Volkskulturen zu rekonstruieren. Seine »Erk<strong>und</strong>ungen<br />
über PierO« dringen weder zu kollektiven Mentalitäten vor noch zu klassenspezifischen<br />
Kulturen, die einander durchdringen oder sich gegeneinander abgrenzen. Es handelt<br />
sich vielmehr im Kern um eine traditionelle ideengeschichtliche Untersuchung.<br />
Ginzburg geht es darum, die Arnalgarnierung politischer Vorstellungen neuer - bürgerlicher<br />
- führender Schichten mit der alten dominanten kirchlichen Sprache ihrer Zeit<br />
nachzuweisen. Um tiefer liegenden Motivationen <strong>und</strong> sozialen Erfahrungen, die nicht<br />
allein in kirchenpolitischen Überlegungen aufgehen, in den Bildern nachzuspüren, hätte<br />
sich Ginzburg auch auf die ästhetische Inszenierung der Motive, sowie auf die Rolle des<br />
Malers bei der Ausführung der Aufträge einlassen müssen. Jutta Held (Osnabrück)<br />
Karl Bloßfeldt 1865-1932. Das fotographische Werk. Mit einem Text von Gert Mattenk1ott.<br />
Verlag Schirmer/Mosel, München 1981 (548 S., Ln., 78,- DM)<br />
»Gleich vorneweg: Das hier ist nicht der 'gesamte Bloßfeldt'. Es handelt sich um das bislang<br />
veröffentlichte <strong>und</strong> hier nun wieder zugänglich gemachte Werk, das vom erhaltenen<br />
fotographischen Gesamtoeuvre ungefahr ein Zehntel ausmacht«, schreibt der Herausgeber<br />
der »Urformen der Kunst« (zuerst 1928) <strong>und</strong> des »W<strong>und</strong>ergarten der Natur« (1930)<br />
Gert Mattenklott in seinem einleitenden Text »Fotographischer Naturalismus um 1900<br />
<strong>und</strong> 1930« (9-67). Nicht nur um den Nachweis der Bedeutung des Fotografen Karl Bloßfeldt<br />
- »einer der Pioniere des neuen Sehens der zwanziger Jahre« (9) - allein geht es<br />
Gert Mattenklott, sondern um die Wiederaneignung des optischen Sinnes durch die Fotogeschichte,<br />
die nicht als ordnende Wissenschaft, sondern als ein Durchgang zu einem<br />
richtigen Sehen ihre Relevanz bekommt: »Eben dabei hilft die Kenntnis der Geschichte<br />
der Fotos, der Absichten, die in sie eingegangen sind, der Abneigungen <strong>und</strong> Vorlieben,<br />
deren Ergebnis sie sind. Bedeutungen, Bildideen, Bildinhalte können so erschlossen werden,<br />
die der aktuell geblendete Blick womöglich übersieht. In diesem Sinn sollte die Fotogeschichte<br />
- statt die Sinne abzulenken - sie aufklären <strong>und</strong> anspitzen.« (11)<br />
Karl Bloßfeldt war mehr Didakt als Künstler. Von 1898 bis zu seinem Tod lehrte erzunächst<br />
als Dozent, ab 1921 als Professor - an der kunstgewerblichen Anstalt in Berlin,<br />
die später der Hochschule <strong>für</strong> Bildende Künste zugeordnet wurde. Bloßfeldts Pflanzenfotografien<br />
dienten als Vorlagen <strong>für</strong> den Zeichen- <strong>und</strong> Modellierunterricht. Die Erstausgabe<br />
der »Urformen der Kunst« stieß auf eine übergreifende Zustimmung, wurde<br />
von der Neuen Sachlichkeit ebenso aufgenommen, wie von den Surrealisten. Analogien<br />
»zu den surrealistischen Frottagen der 'Histoire Naturelle' von Max Ernst« wurden in<br />
der zeitgenössischen Rezeption betont, <strong>und</strong> Georges Bataille illustrierte seinen Aufsatz<br />
über »Le langage des fleurs« in seinen »Documents« mit Bloßfeldt-Fotos« (10). Gert<br />
Mattenklott rekonstruiert in seinem Text, v.ie »das Gefallen an der Schönheit dieser Bilder<br />
aus der Logik des sozialen <strong>und</strong> ästhetischen Umfelds begründet werden« kann (12).<br />
Der Genesis von Bloßfeldts Ästhetik gilt das I. Kapitel »Kunst, Natur <strong>und</strong> Technik um<br />
1900« (13ff.): »Sie ist vielmehr, etwa zu gleichen Teilen, aus Gottfried Sempers Gedanken<br />
über neuen Stil, Ernst Haeckels Naturphilosophie <strong>und</strong> Anregungen aus der Praxis<br />
botanischer Dokumentation zusammengesetzt.« Die frühesten Fotografien - »man hat<br />
das bisher übersehen« - sind in den Lehrbüchern »des <strong>für</strong> den Zeichenunterricht an der<br />
DAS ARGUMENT 136/1982