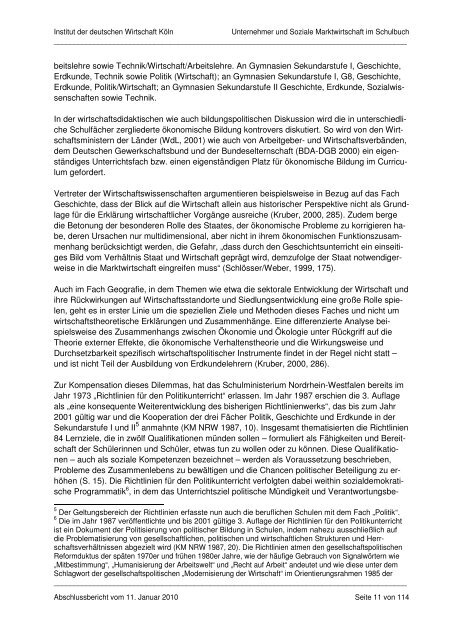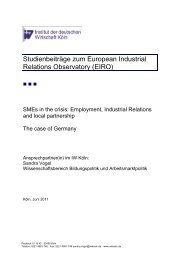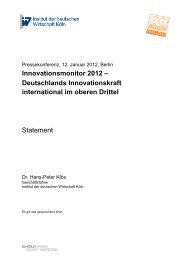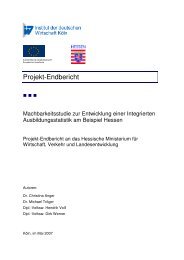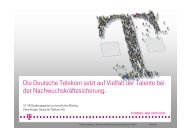Abschlussbericht - IW
Abschlussbericht - IW
Abschlussbericht - IW
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Institut der deutschen Wirtschaft Köln<br />
Unternehmer und Soziale Marktwirtschaft im Schulbuch<br />
________________________________________________________________________________________<br />
beitslehre sowie Technik/Wirtschaft/Arbeitslehre. An Gymnasien Sekundarstufe I, Geschichte,<br />
Erdkunde, Technik sowie Politik (Wirtschaft); an Gymnasien Sekundarstufe I, G8, Geschichte,<br />
Erdkunde, Politik/Wirtschaft; an Gymnasien Sekundarstufe II Geschichte, Erdkunde, Sozialwissenschaften<br />
sowie Technik.<br />
In der wirtschaftsdidaktischen wie auch bildungspolitischen Diskussion wird die in unterschiedliche<br />
Schulfächer zergliederte ökonomische Bildung kontrovers diskutiert. So wird von den Wirtschaftsministern<br />
der Länder (WdL, 2001) wie auch von Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbänden,<br />
dem Deutschen Gewerkschaftsbund und der Bundeselternschaft (BDA-DGB 2000) ein eigenständiges<br />
Unterrichtsfach bzw. einen eigenständigen Platz für ökonomische Bildung im Curriculum<br />
gefordert.<br />
Vertreter der Wirtschaftswissenschaften argumentieren beispielsweise in Bezug auf das Fach<br />
Geschichte, dass der Blick auf die Wirtschaft allein aus historischer Perspektive nicht als Grundlage<br />
für die Erklärung wirtschaftlicher Vorgänge ausreiche (Kruber, 2000, 285). Zudem berge<br />
die Betonung der besonderen Rolle des Staates, der ökonomische Probleme zu korrigieren habe,<br />
deren Ursachen nur multidimensional, aber nicht in ihrem ökonomischen Funktionszusammenhang<br />
berücksichtigt werden, die Gefahr, „dass durch den Geschichtsunterricht ein einseitiges<br />
Bild vom Verhältnis Staat und Wirtschaft geprägt wird, demzufolge der Staat notwendigerweise<br />
in die Marktwirtschaft eingreifen muss“ (Schlösser/Weber, 1999, 175).<br />
Auch im Fach Geografie, in dem Themen wie etwa die sektorale Entwicklung der Wirtschaft und<br />
ihre Rückwirkungen auf Wirtschaftsstandorte und Siedlungsentwicklung eine große Rolle spielen,<br />
geht es in erster Linie um die speziellen Ziele und Methoden dieses Faches und nicht um<br />
wirtschaftstheoretische Erklärungen und Zusammenhänge. Eine differenzierte Analyse beispielsweise<br />
des Zusammenhangs zwischen Ökonomie und Ökologie unter Rückgriff auf die<br />
Theorie externer Effekte, die ökonomische Verhaltenstheorie und die Wirkungsweise und<br />
Durchsetzbarkeit spezifisch wirtschaftspolitischer Instrumente findet in der Regel nicht statt –<br />
und ist nicht Teil der Ausbildung von Erdkundelehrern (Kruber, 2000, 286).<br />
Zur Kompensation dieses Dilemmas, hat das Schulministerium Nordrhein-Westfalen bereits im<br />
Jahr 1973 „Richtlinien für den Politikunterricht“ erlassen. Im Jahr 1987 erschien die 3. Auflage<br />
als „eine konsequente Weiterentwicklung des bisherigen Richtlinienwerks“, das bis zum Jahr<br />
2001 gültig war und die Kooperation der drei Fächer Politik, Geschichte und Erdkunde in der<br />
Sekundarstufe I und II 5 anmahnte (KM NRW 1987, 10). Insgesamt thematisierten die Richtlinien<br />
84 Lernziele, die in zwölf Qualifikationen münden sollen – formuliert als Fähigkeiten und Bereitschaft<br />
der Schülerinnen und Schüler, etwas tun zu wollen oder zu können. Diese Qualifikationen<br />
– auch als soziale Kompetenzen bezeichnet – werden als Voraussetzung beschrieben,<br />
Probleme des Zusammenlebens zu bewältigen und die Chancen politischer Beteiligung zu erhöhen<br />
(S. 15). Die Richtlinien für den Politikunterricht verfolgten dabei weithin sozialdemokratische<br />
Programmatik 6 , in dem das Unterrichtsziel politische Mündigkeit und Verantwortungsbe-<br />
5 Der Geltungsbereich der Richtlinien erfasste nun auch die beruflichen Schulen mit dem Fach „Politik“.<br />
6 Die im Jahr 1987 veröffentlichte und bis 2001 gültige 3. Auflage der Richtlinien für den Politikunterricht<br />
ist ein Dokument der Politisierung von politischer Bildung in Schulen, indem nahezu ausschließlich auf<br />
die Problematisierung von gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Strukturen und Herrschaftsverhältnissen<br />
abgezielt wird (KM NRW 1987, 20). Die Richtlinien atmen den gesellschaftspolitischen<br />
Reformduktus der späten 1970er und frühen 1980er Jahre, wie der häufige Gebrauch von Signalwörtern wie<br />
„Mitbestimmung“, „Humanisierung der Arbeitswelt“ und „Recht auf Arbeit“ andeutet und wie diese unter dem<br />
Schlagwort der gesellschaftspolitischen „Modernisierung der Wirtschaft“ im Orientierungsrahmen 1985 der<br />
________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Abschlussbericht</strong> vom 11. Januar 2010 Seite 11 von 114