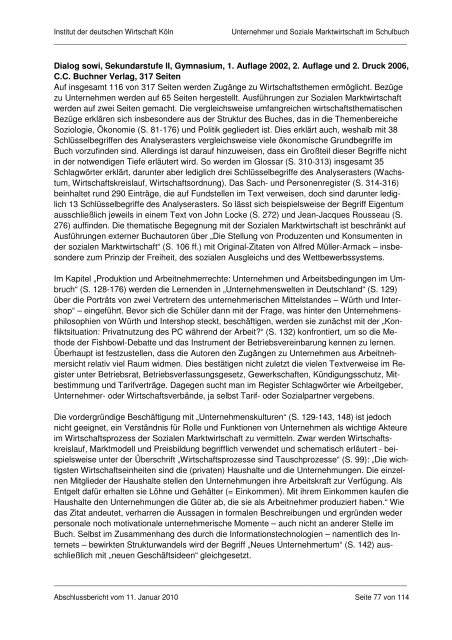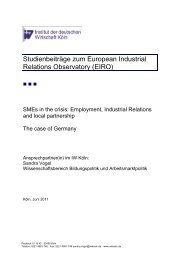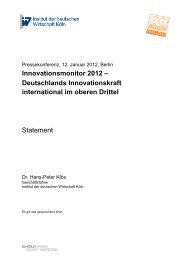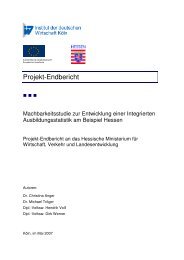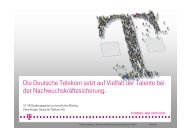Abschlussbericht - IW
Abschlussbericht - IW
Abschlussbericht - IW
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Institut der deutschen Wirtschaft Köln<br />
Unternehmer und Soziale Marktwirtschaft im Schulbuch<br />
________________________________________________________________________________________<br />
Dialog sowi, Sekundarstufe II, Gymnasium, 1. Auflage 2002, 2. Auflage und 2. Druck 2006,<br />
C.C. Buchner Verlag, 317 Seiten<br />
Auf insgesamt 116 von 317 Seiten werden Zugänge zu Wirtschaftsthemen ermöglicht. Bezüge<br />
zu Unternehmen werden auf 65 Seiten hergestellt. Ausführungen zur Sozialen Marktwirtschaft<br />
werden auf zwei Seiten gemacht. Die vergleichsweise umfangreichen wirtschaftsthematischen<br />
Bezüge erklären sich insbesondere aus der Struktur des Buches, das in die Themenbereiche<br />
Soziologie, Ökonomie (S. 81-176) und Politik gegliedert ist. Dies erklärt auch, weshalb mit 38<br />
Schlüsselbegriffen des Analyserasters vergleichsweise viele ökonomische Grundbegriffe im<br />
Buch vorzufinden sind. Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass ein Großteil dieser Begriffe nicht<br />
in der notwendigen Tiefe erläutert wird. So werden im Glossar (S. 310-313) insgesamt 35<br />
Schlagwörter erklärt, darunter aber lediglich drei Schlüsselbegriffe des Analyserasters (Wachstum,<br />
Wirtschaftskreislauf, Wirtschaftsordnung). Das Sach- und Personenregister (S. 314-316)<br />
beinhaltet rund 290 Einträge, die auf Fundstellen im Text verweisen, doch sind darunter lediglich<br />
13 Schlüsselbegriffe des Analyserasters. So lässt sich beispielsweise der Begriff Eigentum<br />
ausschließlich jeweils in einem Text von John Locke (S. 272) und Jean-Jacques Rousseau (S.<br />
276) auffinden. Die thematische Begegnung mit der Sozialen Marktwirtschaft ist beschränkt auf<br />
Ausführungen externer Buchautoren über „Die Stellung von Produzenten und Konsumenten in<br />
der sozialen Marktwirtschaft“ (S. 106 ff.) mit Original-Zitaten von Alfred Müller-Armack – insbesondere<br />
zum Prinzip der Freiheit, des sozialen Ausgleichs und des Wettbewerbssystems.<br />
Im Kapitel „Produktion und Arbeitnehmerrechte: Unternehmen und Arbeitsbedingungen im Umbruch“<br />
(S. 128-176) werden die Lernenden in „Unternehmenswelten in Deutschland“ (S. 129)<br />
über die Porträts von zwei Vertretern des unternehmerischen Mittelstandes – Würth und Intershop“<br />
– eingeführt. Bevor sich die Schüler dann mit der Frage, was hinter den Unternehmensphilosophien<br />
von Würth und Intershop steckt, beschäftigen, werden sie zunächst mit der „Konfliktsituation:<br />
Privatnutzung des PC während der Arbeit?“ (S. 132) konfrontiert, um so die Methode<br />
der Fishbowl-Debatte und das Instrument der Betriebsvereinbarung kennen zu lernen.<br />
Überhaupt ist festzustellen, dass die Autoren den Zugängen zu Unternehmen aus Arbeitnehmersicht<br />
relativ viel Raum widmen. Dies bestätigen nicht zuletzt die vielen Textverweise im Register<br />
unter Betriebsrat, Betriebsverfassungsgesetz, Gewerkschaften, Kündigungsschutz, Mitbestimmung<br />
und Tarifverträge. Dagegen sucht man im Register Schlagwörter wie Arbeitgeber,<br />
Unternehmer- oder Wirtschaftsverbände, ja selbst Tarif- oder Sozialpartner vergebens.<br />
Die vordergründige Beschäftigung mit „Unternehmenskulturen“ (S. 129-143, 148) ist jedoch<br />
nicht geeignet, ein Verständnis für Rolle und Funktionen von Unternehmen als wichtige Akteure<br />
im Wirtschaftsprozess der Sozialen Marktwirtschaft zu vermitteln. Zwar werden Wirtschaftskreislauf,<br />
Marktmodell und Preisbildung begrifflich verwendet und schematisch erläutert - beispielsweise<br />
unter der Überschrift „Wirtschaftsprozesse sind Tauschprozesse“ (S. 99): „Die wichtigsten<br />
Wirtschaftseinheiten sind die (privaten) Haushalte und die Unternehmungen. Die einzelnen<br />
Mitglieder der Haushalte stellen den Unternehmungen ihre Arbeitskraft zur Verfügung. Als<br />
Entgelt dafür erhalten sie Löhne und Gehälter (= Einkommen). Mit ihrem Einkommen kaufen die<br />
Haushalte den Unternehmungen die Güter ab, die sie als Arbeitnehmer produziert haben.“ Wie<br />
das Zitat andeutet, verharren die Aussagen in formalen Beschreibungen und ergründen weder<br />
personale noch motivationale unternehmerische Momente – auch nicht an anderer Stelle im<br />
Buch. Selbst im Zusammenhang des durch die Informationstechnologien – namentlich des Internets<br />
– bewirkten Strukturwandels wird der Begriff „Neues Unternehmertum“ (S. 142) ausschließlich<br />
mit „neuen Geschäftsideen“ gleichgesetzt.<br />
________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Abschlussbericht</strong> vom 11. Januar 2010 Seite 77 von 114