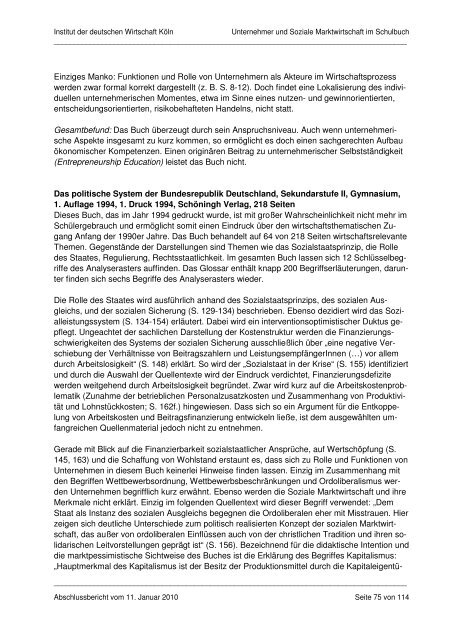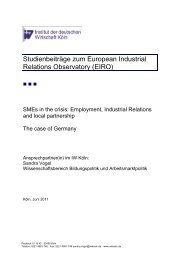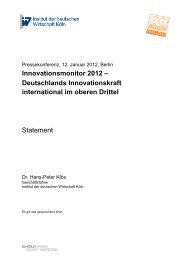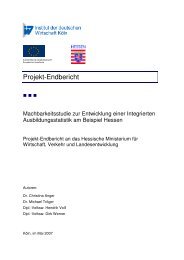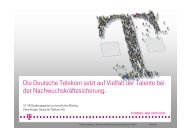Abschlussbericht - IW
Abschlussbericht - IW
Abschlussbericht - IW
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Institut der deutschen Wirtschaft Köln<br />
Unternehmer und Soziale Marktwirtschaft im Schulbuch<br />
________________________________________________________________________________________<br />
Einziges Manko: Funktionen und Rolle von Unternehmern als Akteure im Wirtschaftsprozess<br />
werden zwar formal korrekt dargestellt (z. B. S. 8-12). Doch findet eine Lokalisierung des individuellen<br />
unternehmerischen Momentes, etwa im Sinne eines nutzen- und gewinnorientierten,<br />
entscheidungsorientierten, risikobehafteten Handelns, nicht statt.<br />
Gesamtbefund: Das Buch überzeugt durch sein Anspruchsniveau. Auch wenn unternehmerische<br />
Aspekte insgesamt zu kurz kommen, so ermöglicht es doch einen sachgerechten Aufbau<br />
ökonomischer Kompetenzen. Einen originären Beitrag zu unternehmerischer Selbstständigkeit<br />
(Entrepreneurship Education) leistet das Buch nicht.<br />
Das politische System der Bundesrepublik Deutschland, Sekundarstufe II, Gymnasium,<br />
1. Auflage 1994, 1. Druck 1994, Schöningh Verlag, 218 Seiten<br />
Dieses Buch, das im Jahr 1994 gedruckt wurde, ist mit großer Wahrscheinlichkeit nicht mehr im<br />
Schülergebrauch und ermöglicht somit einen Eindruck über den wirtschaftsthematischen Zugang<br />
Anfang der 1990er Jahre. Das Buch behandelt auf 64 von 218 Seiten wirtschaftsrelevante<br />
Themen. Gegenstände der Darstellungen sind Themen wie das Sozialstaatsprinzip, die Rolle<br />
des Staates, Regulierung, Rechtsstaatlichkeit. Im gesamten Buch lassen sich 12 Schlüsselbegriffe<br />
des Analyserasters auffinden. Das Glossar enthält knapp 200 Begriffserläuterungen, darunter<br />
finden sich sechs Begriffe des Analyserasters wieder.<br />
Die Rolle des Staates wird ausführlich anhand des Sozialstaatsprinzips, des sozialen Ausgleichs,<br />
und der sozialen Sicherung (S. 129-134) beschrieben. Ebenso dezidiert wird das Sozialleistungssystem<br />
(S. 134-154) erläutert. Dabei wird ein interventionsoptimistischer Duktus gepflegt.<br />
Ungeachtet der sachlichen Darstellung der Kostenstruktur werden die Finanzierungsschwierigkeiten<br />
des Systems der sozialen Sicherung ausschließlich über „eine negative Verschiebung<br />
der Verhältnisse von Beitragszahlern und LeistungsempfängerInnen (…) vor allem<br />
durch Arbeitslosigkeit“ (S. 148) erklärt. So wird der „Sozialstaat in der Krise“ (S. 155) identifiziert<br />
und durch die Auswahl der Quellentexte wird der Eindruck verdichtet, Finanzierungsdefizite<br />
werden weitgehend durch Arbeitslosigkeit begründet. Zwar wird kurz auf die Arbeitskostenproblematik<br />
(Zunahme der betrieblichen Personalzusatzkosten und Zusammenhang von Produktivität<br />
und Lohnstückkosten; S. 162f.) hingewiesen. Dass sich so ein Argument für die Entkoppelung<br />
von Arbeitskosten und Beitragsfinanzierung entwickeln ließe, ist dem ausgewählten umfangreichen<br />
Quellenmaterial jedoch nicht zu entnehmen.<br />
Gerade mit Blick auf die Finanzierbarkeit sozialstaatlicher Ansprüche, auf Wertschöpfung (S.<br />
145, 163) und die Schaffung von Wohlstand erstaunt es, dass sich zu Rolle und Funktionen von<br />
Unternehmen in diesem Buch keinerlei Hinweise finden lassen. Einzig im Zusammenhang mit<br />
den Begriffen Wettbewerbsordnung, Wettbewerbsbeschränkungen und Ordoliberalismus werden<br />
Unternehmen begrifflich kurz erwähnt. Ebenso werden die Soziale Marktwirtschaft und ihre<br />
Merkmale nicht erklärt. Einzig im folgenden Quellentext wird dieser Begriff verwendet: „Dem<br />
Staat als Instanz des sozialen Ausgleichs begegnen die Ordoliberalen eher mit Misstrauen. Hier<br />
zeigen sich deutliche Unterschiede zum politisch realisierten Konzept der sozialen Marktwirtschaft,<br />
das außer von ordoliberalen Einflüssen auch von der christlichen Tradition und ihren solidarischen<br />
Leitvorstellungen geprägt ist“ (S. 156). Bezeichnend für die didaktische Intention und<br />
die marktpessimistische Sichtweise des Buches ist die Erklärung des Begriffes Kapitalismus:<br />
„Hauptmerkmal des Kapitalismus ist der Besitz der Produktionsmittel durch die Kapitaleigentü-<br />
________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Abschlussbericht</strong> vom 11. Januar 2010 Seite 75 von 114