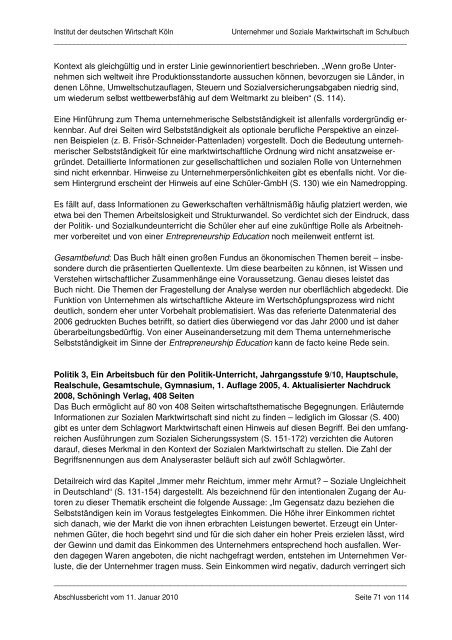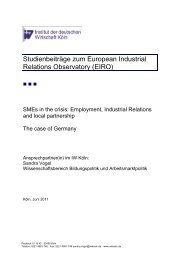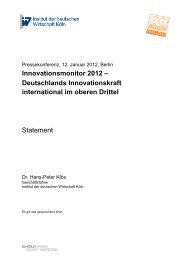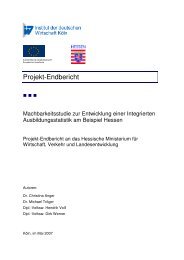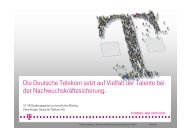Abschlussbericht - IW
Abschlussbericht - IW
Abschlussbericht - IW
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Institut der deutschen Wirtschaft Köln<br />
Unternehmer und Soziale Marktwirtschaft im Schulbuch<br />
________________________________________________________________________________________<br />
Kontext als gleichgültig und in erster Linie gewinnorientiert beschrieben. „Wenn große Unternehmen<br />
sich weltweit ihre Produktionsstandorte aussuchen können, bevorzugen sie Länder, in<br />
denen Löhne, Umweltschutzauflagen, Steuern und Sozialversicherungsabgaben niedrig sind,<br />
um wiederum selbst wettbewerbsfähig auf dem Weltmarkt zu bleiben“ (S. 114).<br />
Eine Hinführung zum Thema unternehmerische Selbstständigkeit ist allenfalls vordergründig erkennbar.<br />
Auf drei Seiten wird Selbstständigkeit als optionale berufliche Perspektive an einzelnen<br />
Beispielen (z. B. Frisör-Schneider-Pattenladen) vorgestellt. Doch die Bedeutung unternehmerischer<br />
Selbstständigkeit für eine marktwirtschaftliche Ordnung wird nicht ansatzweise ergründet.<br />
Detaillierte Informationen zur gesellschaftlichen und sozialen Rolle von Unternehmen<br />
sind nicht erkennbar. Hinweise zu Unternehmerpersönlichkeiten gibt es ebenfalls nicht. Vor diesem<br />
Hintergrund erscheint der Hinweis auf eine Schüler-GmbH (S. 130) wie ein Namedropping.<br />
Es fällt auf, dass Informationen zu Gewerkschaften verhältnismäßig häufig platziert werden, wie<br />
etwa bei den Themen Arbeitslosigkeit und Strukturwandel. So verdichtet sich der Eindruck, dass<br />
der Politik- und Sozialkundeunterricht die Schüler eher auf eine zukünftige Rolle als Arbeitnehmer<br />
vorbereitet und von einer Entrepreneurship Education noch meilenweit entfernt ist.<br />
Gesamtbefund: Das Buch hält einen großen Fundus an ökonomischen Themen bereit – insbesondere<br />
durch die präsentierten Quellentexte. Um diese bearbeiten zu können, ist Wissen und<br />
Verstehen wirtschaftlicher Zusammenhänge eine Voraussetzung. Genau dieses leistet das<br />
Buch nicht. Die Themen der Fragestellung der Analyse werden nur oberflächlich abgedeckt. Die<br />
Funktion von Unternehmen als wirtschaftliche Akteure im Wertschöpfungsprozess wird nicht<br />
deutlich, sondern eher unter Vorbehalt problematisiert. Was das referierte Datenmaterial des<br />
2006 gedruckten Buches betrifft, so datiert dies überwiegend vor das Jahr 2000 und ist daher<br />
überarbeitungsbedürftig. Von einer Auseinandersetzung mit dem Thema unternehmerische<br />
Selbstständigkeit im Sinne der Entrepreneurship Education kann de facto keine Rede sein.<br />
Politik 3, Ein Arbeitsbuch für den Politik-Unterricht, Jahrgangsstufe 9/10, Hauptschule,<br />
Realschule, Gesamtschule, Gymnasium, 1. Auflage 2005, 4. Aktualisierter Nachdruck<br />
2008, Schöningh Verlag, 408 Seiten<br />
Das Buch ermöglicht auf 80 von 408 Seiten wirtschaftsthematische Begegnungen. Erläuternde<br />
Informationen zur Sozialen Marktwirtschaft sind nicht zu finden – lediglich im Glossar (S. 400)<br />
gibt es unter dem Schlagwort Marktwirtschaft einen Hinweis auf diesen Begriff. Bei den umfangreichen<br />
Ausführungen zum Sozialen Sicherungssystem (S. 151-172) verzichten die Autoren<br />
darauf, dieses Merkmal in den Kontext der Sozialen Marktwirtschaft zu stellen. Die Zahl der<br />
Begriffsnennungen aus dem Analyseraster beläuft sich auf zwölf Schlagwörter.<br />
Detailreich wird das Kapitel „Immer mehr Reichtum, immer mehr Armut? – Soziale Ungleichheit<br />
in Deutschland“ (S. 131-154) dargestellt. Als bezeichnend für den intentionalen Zugang der Autoren<br />
zu dieser Thematik erscheint die folgende Aussage: „Im Gegensatz dazu beziehen die<br />
Selbstständigen kein im Voraus festgelegtes Einkommen. Die Höhe ihrer Einkommen richtet<br />
sich danach, wie der Markt die von ihnen erbrachten Leistungen bewertet. Erzeugt ein Unternehmen<br />
Güter, die hoch begehrt sind und für die sich daher ein hoher Preis erzielen lässt, wird<br />
der Gewinn und damit das Einkommen des Unternehmers entsprechend hoch ausfallen. Werden<br />
dagegen Waren angeboten, die nicht nachgefragt werden, entstehen im Unternehmen Verluste,<br />
die der Unternehmer tragen muss. Sein Einkommen wird negativ, dadurch verringert sich<br />
________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Abschlussbericht</strong> vom 11. Januar 2010 Seite 71 von 114