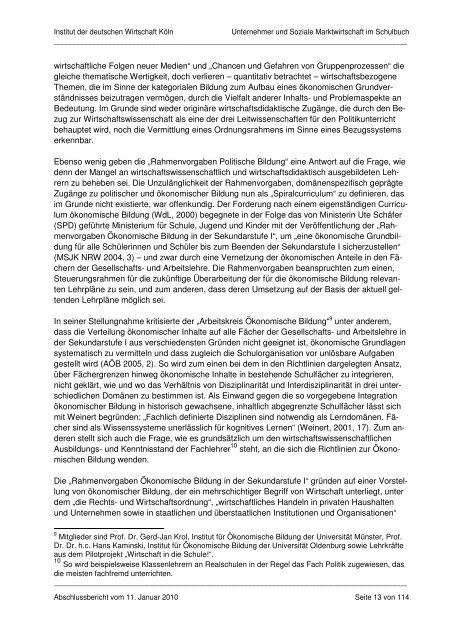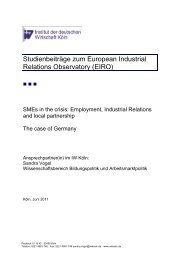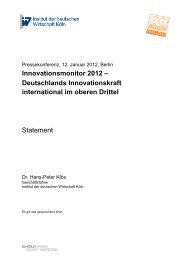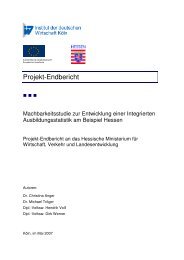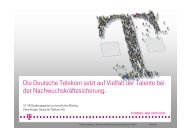Abschlussbericht - IW
Abschlussbericht - IW
Abschlussbericht - IW
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Institut der deutschen Wirtschaft Köln<br />
Unternehmer und Soziale Marktwirtschaft im Schulbuch<br />
________________________________________________________________________________________<br />
wirtschaftliche Folgen neuer Medien“ und „Chancen und Gefahren von Gruppenprozessen“ die<br />
gleiche thematische Wertigkeit, doch verlieren – quantitativ betrachtet – wirtschaftsbezogene<br />
Themen, die im Sinne der kategorialen Bildung zum Aufbau eines ökonomischen Grundverständnisses<br />
beizutragen vermögen, durch die Vielfalt anderer Inhalts- und Problemaspekte an<br />
Bedeutung. Im Grunde sind weder originäre wirtschaftsdidaktische Zugänge, die durch den Bezug<br />
zur Wirtschaftswissenschaft als eine der drei Leitwissenschaften für den Politikunterricht<br />
behauptet wird, noch die Vermittlung eines Ordnungsrahmens im Sinne eines Bezugssystems<br />
erkennbar.<br />
Ebenso wenig geben die „Rahmenvorgaben Politische Bildung“ eine Antwort auf die Frage, wie<br />
denn der Mangel an wirtschaftswissenschaftlich und wirtschaftsdidaktisch ausgebildeten Lehrern<br />
zu beheben sei. Die Unzulänglichkeit der Rahmenvorgaben, domänenspezifisch geprägte<br />
Zugänge zu politischer und ökonomischer Bildung nun als „Spiralcurriculum“ zu definieren, das<br />
im Grunde nicht existierte, war offenkundig. Der Forderung nach einem eigenständigen Curriculum<br />
ökonomische Bildung (WdL, 2000) begegnete in der Folge das von Ministerin Ute Schäfer<br />
(SPD) geführte Ministerium für Schule, Jugend und Kinder mit der Veröffentlichung der „Rahmenvorgaben<br />
Ökonomische Bildung in der Sekundarstufe I“, um „eine ökonomische Grundbildung<br />
für alle Schülerinnen und Schüler bis zum Beenden der Sekundarstufe I sicherzustellen“<br />
(MSJK NRW 2004, 3) – und zwar durch eine Vernetzung der ökonomischen Anteile in den Fächern<br />
der Gesellschafts- und Arbeitslehre. Die Rahmenvorgaben beanspruchten zum einen,<br />
Steuerungsrahmen für die zukünftige Überarbeitung der für die ökonomische Bildung relevanten<br />
Lehrpläne zu sein, und zum anderen, dass deren Umsetzung auf der Basis der aktuell geltenden<br />
Lehrpläne möglich sei.<br />
In seiner Stellungnahme kritisierte der „Arbeitskreis Ökonomische Bildung“ 9 unter anderem,<br />
dass die Verteilung ökonomischer Inhalte auf alle Fächer der Gesellschafts- und Arbeitslehre in<br />
der Sekundarstufe I aus verschiedensten Gründen nicht geeignet ist, ökonomische Grundlagen<br />
systematisch zu vermitteln und dass zugleich die Schulorganisation vor unlösbare Aufgaben<br />
gestellt wird (AÖB 2005, 2). So wird zum einen bei dem in den Richtlinien dargelegten Ansatz,<br />
über Fächergrenzen hinweg ökonomische Inhalte in bestehende Schulfächer zu integrieren,<br />
nicht geklärt, wie und wo das Verhältnis von Disziplinarität und Interdisziplinarität in drei unterschiedlichen<br />
Domänen zu bestimmen ist. Als Einwand gegen die so vorgegebene Integration<br />
ökonomischer Bildung in historisch gewachsene, inhaltlich abgegrenzte Schulfächer lässt sich<br />
mit Weinert begründen: „Fachlich definierte Disziplinen sind notwendig als Lerndomänen. Fächer<br />
sind als Wissenssysteme unerlässlich für kognitives Lernen“ (Weinert, 2001, 17). Zum anderen<br />
stellt sich auch die Frage, wie es grundsätzlich um den wirtschaftswissenschaftlichen<br />
Ausbildungs- und Kenntnisstand der Fachlehrer 10 steht, an die sich die Richtlinien zur Ökonomischen<br />
Bildung wenden.<br />
Die „Rahmenvorgaben Ökonomische Bildung in der Sekundarstufe I“ gründen auf einer Vorstellung<br />
von ökonomischer Bildung, der ein mehrschichtiger Begriff von Wirtschaft unterliegt, unter<br />
dem „die Rechts- und Wirtschaftsordnung“, „wirtschaftliches Handeln in privaten Haushalten<br />
und Unternehmen sowie in staatlichen und überstaatlichen Institutionen und Organisationen“<br />
9 Mitglieder sind Prof. Dr. Gerd-Jan Krol, Institut für Ökonomische Bildung der Universität Münster, Prof.<br />
Dr. Dr. h.c. Hans Kaminski, Institut für Ökonomische Bildung der Universität Oldenburg sowie Lehrkräfte<br />
aus dem Pilotprojekt „Wirtschaft in die Schule!“.<br />
10 So wird beispielsweise Klassenlehrern an Realschulen in der Regel das Fach Politik zugewiesen, das<br />
die meisten fachfremd unterrichten.<br />
________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Abschlussbericht</strong> vom 11. Januar 2010 Seite 13 von 114