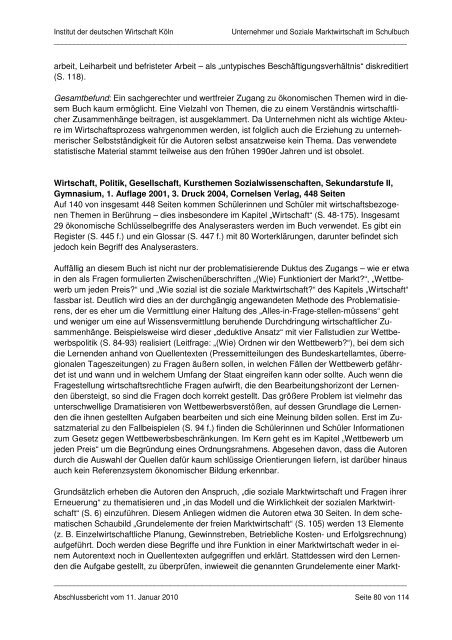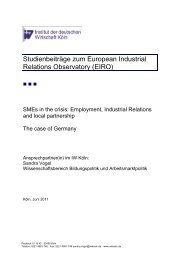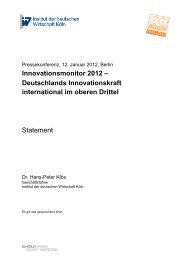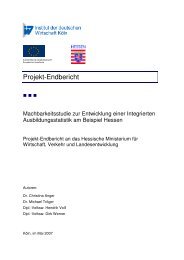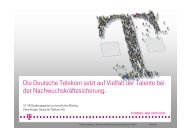Abschlussbericht - IW
Abschlussbericht - IW
Abschlussbericht - IW
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Institut der deutschen Wirtschaft Köln<br />
Unternehmer und Soziale Marktwirtschaft im Schulbuch<br />
________________________________________________________________________________________<br />
arbeit, Leiharbeit und befristeter Arbeit – als „untypisches Beschäftigungsverhältnis“ diskreditiert<br />
(S. 118).<br />
Gesamtbefund: Ein sachgerechter und wertfreier Zugang zu ökonomischen Themen wird in diesem<br />
Buch kaum ermöglicht. Eine Vielzahl von Themen, die zu einem Verständnis wirtschaftlicher<br />
Zusammenhänge beitragen, ist ausgeklammert. Da Unternehmen nicht als wichtige Akteure<br />
im Wirtschaftsprozess wahrgenommen werden, ist folglich auch die Erziehung zu unternehmerischer<br />
Selbstständigkeit für die Autoren selbst ansatzweise kein Thema. Das verwendete<br />
statistische Material stammt teilweise aus den frühen 1990er Jahren und ist obsolet.<br />
Wirtschaft, Politik, Gesellschaft, Kursthemen Sozialwissenschaften, Sekundarstufe II,<br />
Gymnasium, 1. Auflage 2001, 3. Druck 2004, Cornelsen Verlag, 448 Seiten<br />
Auf 140 von insgesamt 448 Seiten kommen Schülerinnen und Schüler mit wirtschaftsbezogenen<br />
Themen in Berührung – dies insbesondere im Kapitel „Wirtschaft“ (S. 48-175). Insgesamt<br />
29 ökonomische Schlüsselbegriffe des Analyserasters werden im Buch verwendet. Es gibt ein<br />
Register (S. 445 f.) und ein Glossar (S. 447 f.) mit 80 Worterklärungen, darunter befindet sich<br />
jedoch kein Begriff des Analyserasters.<br />
Auffällig an diesem Buch ist nicht nur der problematisierende Duktus des Zugangs – wie er etwa<br />
in den als Fragen formulierten Zwischenüberschriften „(Wie) Funktioniert der Markt?“, „Wettbewerb<br />
um jeden Preis?“ und „Wie sozial ist die soziale Marktwirtschaft?“ des Kapitels „Wirtschaft“<br />
fassbar ist. Deutlich wird dies an der durchgängig angewandeten Methode des Problematisierens,<br />
der es eher um die Vermittlung einer Haltung des „Alles-in-Frage-stellen-müssens“ geht<br />
und weniger um eine auf Wissensvermittlung beruhende Durchdringung wirtschaftlicher Zusammenhänge.<br />
Beispielsweise wird dieser „deduktive Ansatz“ mit vier Fallstudien zur Wettbewerbspolitik<br />
(S. 84-93) realisiert (Leitfrage: „(Wie) Ordnen wir den Wettbewerb?“), bei dem sich<br />
die Lernenden anhand von Quellentexten (Pressemitteilungen des Bundeskartellamtes, überregionalen<br />
Tageszeitungen) zu Fragen äußern sollen, in welchen Fällen der Wettbewerb gefährdet<br />
ist und wann und in welchem Umfang der Staat eingreifen kann oder sollte. Auch wenn die<br />
Fragestellung wirtschaftsrechtliche Fragen aufwirft, die den Bearbeitungshorizont der Lernenden<br />
übersteigt, so sind die Fragen doch korrekt gestellt. Das größere Problem ist vielmehr das<br />
unterschwellige Dramatisieren von Wettbewerbsverstößen, auf dessen Grundlage die Lernenden<br />
die ihnen gestellten Aufgaben bearbeiten und sich eine Meinung bilden sollen. Erst im Zusatzmaterial<br />
zu den Fallbeispielen (S. 94 f.) finden die Schülerinnen und Schüler Informationen<br />
zum Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen. Im Kern geht es im Kapitel „Wettbewerb um<br />
jeden Preis“ um die Begründung eines Ordnungsrahmens. Abgesehen davon, dass die Autoren<br />
durch die Auswahl der Quellen dafür kaum schlüssige Orientierungen liefern, ist darüber hinaus<br />
auch kein Referenzsystem ökonomischer Bildung erkennbar.<br />
Grundsätzlich erheben die Autoren den Anspruch, „die soziale Marktwirtschaft und Fragen ihrer<br />
Erneuerung“ zu thematisieren und „in das Modell und die Wirklichkeit der sozialen Marktwirtschaft“<br />
(S. 6) einzuführen. Diesem Anliegen widmen die Autoren etwa 30 Seiten. In dem schematischen<br />
Schaubild „Grundelemente der freien Marktwirtschaft“ (S. 105) werden 13 Elemente<br />
(z. B. Einzelwirtschaftliche Planung, Gewinnstreben, Betriebliche Kosten- und Erfolgsrechnung)<br />
aufgeführt. Doch werden diese Begriffe und ihre Funktion in einer Marktwirtschaft weder in einem<br />
Autorentext noch in Quellentexten aufgegriffen und erklärt. Stattdessen wird den Lernenden<br />
die Aufgabe gestellt, zu überprüfen, inwieweit die genannten Grundelemente einer Markt-<br />
________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Abschlussbericht</strong> vom 11. Januar 2010 Seite 80 von 114