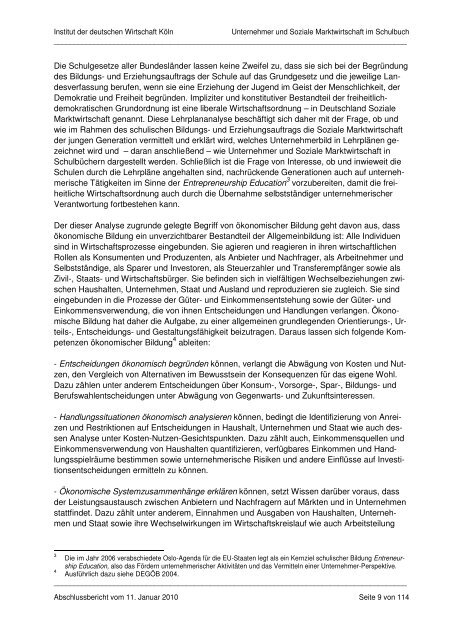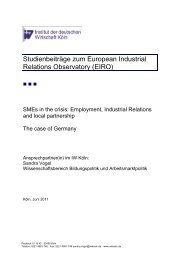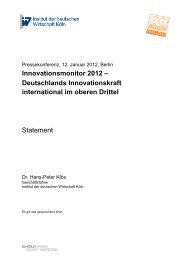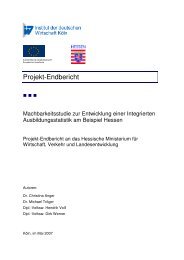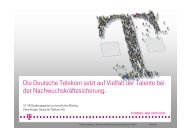Abschlussbericht - IW
Abschlussbericht - IW
Abschlussbericht - IW
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Institut der deutschen Wirtschaft Köln<br />
Unternehmer und Soziale Marktwirtschaft im Schulbuch<br />
________________________________________________________________________________________<br />
Die Schulgesetze aller Bundesländer lassen keine Zweifel zu, dass sie sich bei der Begründung<br />
des Bildungs- und Erziehungsauftrags der Schule auf das Grundgesetz und die jeweilige Landesverfassung<br />
berufen, wenn sie eine Erziehung der Jugend im Geist der Menschlichkeit, der<br />
Demokratie und Freiheit begründen. Impliziter und konstitutiver Bestandteil der freiheitlichdemokratischen<br />
Grundordnung ist eine liberale Wirtschaftsordnung – in Deutschland Soziale<br />
Marktwirtschaft genannt. Diese Lehrplananalyse beschäftigt sich daher mit der Frage, ob und<br />
wie im Rahmen des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags die Soziale Marktwirtschaft<br />
der jungen Generation vermittelt und erklärt wird, welches Unternehmerbild in Lehrplänen gezeichnet<br />
wird und – daran anschließend – wie Unternehmer und Soziale Marktwirtschaft in<br />
Schulbüchern dargestellt werden. Schließlich ist die Frage von Interesse, ob und inwieweit die<br />
Schulen durch die Lehrpläne angehalten sind, nachrückende Generationen auch auf unternehmerische<br />
Tätigkeiten im Sinne der Entrepreneurship Education 3 vorzubereiten, damit die freiheitliche<br />
Wirtschaftsordnung auch durch die Übernahme selbstständiger unternehmerischer<br />
Verantwortung fortbestehen kann.<br />
Der dieser Analyse zugrunde gelegte Begriff von ökonomischer Bildung geht davon aus, dass<br />
ökonomische Bildung ein unverzichtbarer Bestandteil der Allgemeinbildung ist: Alle Individuen<br />
sind in Wirtschaftsprozesse eingebunden. Sie agieren und reagieren in ihren wirtschaftlichen<br />
Rollen als Konsumenten und Produzenten, als Anbieter und Nachfrager, als Arbeitnehmer und<br />
Selbstständige, als Sparer und Investoren, als Steuerzahler und Transferempfänger sowie als<br />
Zivil-, Staats- und Wirtschaftsbürger. Sie befinden sich in vielfältigen Wechselbeziehungen zwischen<br />
Haushalten, Unternehmen, Staat und Ausland und reproduzieren sie zugleich. Sie sind<br />
eingebunden in die Prozesse der Güter- und Einkommensentstehung sowie der Güter- und<br />
Einkommensverwendung, die von ihnen Entscheidungen und Handlungen verlangen. Ökonomische<br />
Bildung hat daher die Aufgabe, zu einer allgemeinen grundlegenden Orientierungs-, Urteils-,<br />
Entscheidungs- und Gestaltungsfähigkeit beizutragen. Daraus lassen sich folgende Kompetenzen<br />
ökonomischer Bildung 4 ableiten:<br />
- Entscheidungen ökonomisch begründen können, verlangt die Abwägung von Kosten und Nutzen,<br />
den Vergleich von Alternativen im Bewusstsein der Konsequenzen für das eigene Wohl.<br />
Dazu zählen unter anderem Entscheidungen über Konsum-, Vorsorge-, Spar-, Bildungs- und<br />
Berufswahlentscheidungen unter Abwägung von Gegenwarts- und Zukunftsinteressen.<br />
- Handlungssituationen ökonomisch analysieren können, bedingt die Identifizierung von Anreizen<br />
und Restriktionen auf Entscheidungen in Haushalt, Unternehmen und Staat wie auch dessen<br />
Analyse unter Kosten-Nutzen-Gesichtspunkten. Dazu zählt auch, Einkommensquellen und<br />
Einkommensverwendung von Haushalten quantifizieren, verfügbares Einkommen und Handlungsspielräume<br />
bestimmen sowie unternehmerische Risiken und andere Einflüsse auf Investitionsentscheidungen<br />
ermitteln zu können.<br />
- Ökonomische Systemzusammenhänge erklären können, setzt Wissen darüber voraus, dass<br />
der Leistungsaustausch zwischen Anbietern und Nachfragern auf Märkten und in Unternehmen<br />
stattfindet. Dazu zählt unter anderem, Einnahmen und Ausgaben von Haushalten, Unternehmen<br />
und Staat sowie ihre Wechselwirkungen im Wirtschaftskreislauf wie auch Arbeitsteilung<br />
3<br />
Die im Jahr 2006 verabschiedete Oslo-Agenda für die EU-Staaten legt als ein Kernziel schulischer Bildung Entreneurship<br />
Education, also das Fördern unternehmerischer Aktivitäten und das Vermitteln einer Unternehmer-Perspektive.<br />
4<br />
Ausführlich dazu siehe DEGÖB 2004.<br />
________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Abschlussbericht</strong> vom 11. Januar 2010 Seite 9 von 114