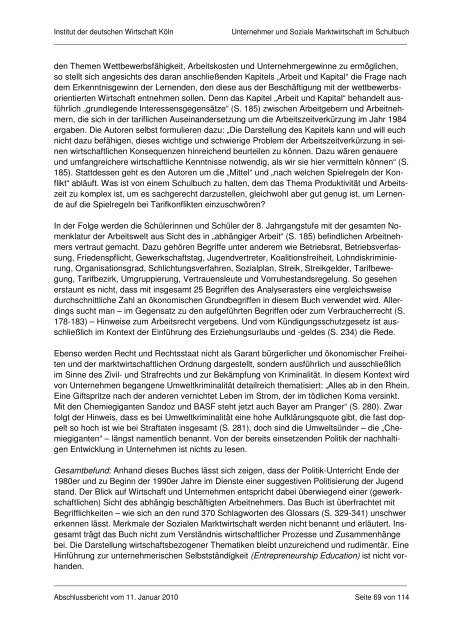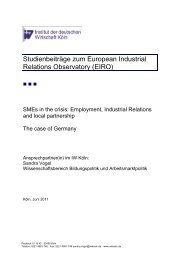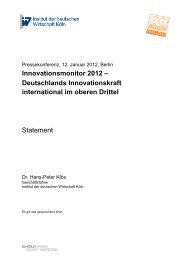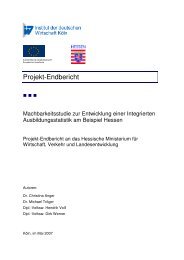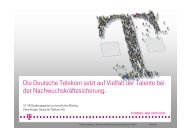Abschlussbericht - IW
Abschlussbericht - IW
Abschlussbericht - IW
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Institut der deutschen Wirtschaft Köln<br />
Unternehmer und Soziale Marktwirtschaft im Schulbuch<br />
________________________________________________________________________________________<br />
den Themen Wettbewerbsfähigkeit, Arbeitskosten und Unternehmergewinne zu ermöglichen,<br />
so stellt sich angesichts des daran anschließenden Kapitels „Arbeit und Kapital“ die Frage nach<br />
dem Erkenntnisgewinn der Lernenden, den diese aus der Beschäftigung mit der wettbewerbsorientierten<br />
Wirtschaft entnehmen sollen. Denn das Kapitel „Arbeit und Kapital“ behandelt ausführlich<br />
„grundlegende Interessensgegensätze“ (S. 185) zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern,<br />
die sich in der tariflichen Auseinandersetzung um die Arbeitszeitverkürzung im Jahr 1984<br />
ergaben. Die Autoren selbst formulieren dazu: „Die Darstellung des Kapitels kann und will euch<br />
nicht dazu befähigen, dieses wichtige und schwierige Problem der Arbeitszeitverkürzung in seinen<br />
wirtschaftlichen Konsequenzen hinreichend beurteilen zu können. Dazu wären genauere<br />
und umfangreichere wirtschaftliche Kenntnisse notwendig, als wir sie hier vermitteln können“ (S.<br />
185). Stattdessen geht es den Autoren um die „Mittel“ und „nach welchen Spielregeln der Konflikt“<br />
abläuft. Was ist von einem Schulbuch zu halten, dem das Thema Produktivität und Arbeitszeit<br />
zu komplex ist, um es sachgerecht darzustellen, gleichwohl aber gut genug ist, um Lernende<br />
auf die Spielregeln bei Tarifkonflikten einzuschwören?<br />
In der Folge werden die Schülerinnen und Schüler der 8. Jahrgangstufe mit der gesamten Nomenklatur<br />
der Arbeitswelt aus Sicht des in „abhängiger Arbeit“ (S. 185) befindlichen Arbeitnehmers<br />
vertraut gemacht. Dazu gehören Begriffe unter anderem wie Betriebsrat, Betriebsverfassung,<br />
Friedenspflicht, Gewerkschaftstag, Jugendvertreter, Koalitionsfreiheit, Lohndiskriminierung,<br />
Organisationsgrad, Schlichtungsverfahren, Sozialplan, Streik, Streikgelder, Tarifbewegung,<br />
Tarifbezirk, Umgruppierung, Vertrauensleute und Vorruhestandsregelung. So gesehen<br />
erstaunt es nicht, dass mit insgesamt 25 Begriffen des Analyserasters eine vergleichsweise<br />
durchschnittliche Zahl an ökonomischen Grundbegriffen in diesem Buch verwendet wird. Allerdings<br />
sucht man – im Gegensatz zu den aufgeführten Begriffen oder zum Verbraucherrecht (S.<br />
178-183) – Hinweise zum Arbeitsrecht vergebens. Und vom Kündigungsschutzgesetz ist ausschließlich<br />
im Kontext der Einführung des Erziehungsurlaubs und -geldes (S. 234) die Rede.<br />
Ebenso werden Recht und Rechtsstaat nicht als Garant bürgerlicher und ökonomischer Freiheiten<br />
und der marktwirtschaftlichen Ordnung dargestellt, sondern ausführlich und ausschließlich<br />
im Sinne des Zivil- und Strafrechts und zur Bekämpfung von Kriminalität. In diesem Kontext wird<br />
von Unternehmen begangene Umweltkriminalität detailreich thematisiert: „Alles ab in den Rhein.<br />
Eine Giftspritze nach der anderen vernichtet Leben im Strom, der im tödlichen Koma versinkt.<br />
Mit den Chemiegiganten Sandoz und BASF steht jetzt auch Bayer am Pranger“ (S. 280). Zwar<br />
folgt der Hinweis, dass es bei Umweltkriminalität eine hohe Aufklärungsquote gibt, die fast doppelt<br />
so hoch ist wie bei Straftaten insgesamt (S. 281), doch sind die Umweltsünder – die „Chemiegiganten“<br />
– längst namentlich benannt. Von der bereits einsetzenden Politik der nachhaltigen<br />
Entwicklung in Unternehmen ist nichts zu lesen.<br />
Gesamtbefund: Anhand dieses Buches lässt sich zeigen, dass der Politik-Unterricht Ende der<br />
1980er und zu Beginn der 1990er Jahre im Dienste einer suggestiven Politisierung der Jugend<br />
stand. Der Blick auf Wirtschaft und Unternehmen entspricht dabei überwiegend einer (gewerkschaftlichen)<br />
Sicht des abhängig beschäftigten Arbeitnehmers. Das Buch ist überfrachtet mit<br />
Begrifflichkeiten – wie sich an den rund 370 Schlagworten des Glossars (S. 329-341) unschwer<br />
erkennen lässt. Merkmale der Sozialen Marktwirtschaft werden nicht benannt und erläutert. Insgesamt<br />
trägt das Buch nicht zum Verständnis wirtschaftlicher Prozesse und Zusammenhänge<br />
bei. Die Darstellung wirtschaftsbezogener Thematiken bleibt unzureichend und rudimentär. Eine<br />
Hinführung zur unternehmerischen Selbstständigkeit (Entrepreneurship Education) ist nicht vorhanden.<br />
________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Abschlussbericht</strong> vom 11. Januar 2010 Seite 69 von 114